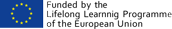Als junge angehende Übersetzerin bin ich ständig mit Vorurteilen über ÜbersetzerInnen und über das Übersetzen konfrontiert. Generell teile ich die (von mir) so genannten Nichtübersetzer in zwei Gruppen ein.
Zur ersten Gruppe gehören Menschen, die keine ausgebildeten ÜbersetzerInnen sind und die sich auch nie im Leben mit dem Übersetzen beschäftigt haben. Von ihnen höre ich immer dieselben Fragen: »Bedeutet das, dass du ganze Wörterbücher auswendig kannst? Sag mal, wie heißt »[beliebiges Wort einsetzen]« auf Deutsch/Englisch/[beliebige Sprache einsetzen]?« Und manchmal folgen solchen Fragen noch aufdringliche Bitten im Sinne von »Könntest du mir vielleicht diese zwei Seiten ganz schnell übersetzen? Das muss nicht genau gemacht werden, nur so, ganz schnell.« Natürlich denken sie im Traum nicht daran, mir für diese »ganz schnelle« Übersetzung auch nur einen einzigen Cent zu bezahlen. Ihrer Meinung nach braucht man für eine zweiseitige Übersetzung »so ungefähr dreißig Minuten«. Und eine halbe Stunde würde ich doch gerne opfern, um ihnen diesen Gefallen zu erweisen. Dabei wird deutlich, dass sie weder mir noch meinem Beruf gegenüber Respekt zollen.
Zur zweiten Gruppe gehören Menschen, deren Meinung nach man als Übersetzer nur den Ausgangstext verstehen muss. Solche Menschen bitten mich erst dann um Hilfe, wenn ihre Übersetzung von jemandem (meistens ist es ihr Professor) abgelehnt wird, weil sie einfach nicht verständlich ist. Diese Typen von Nichtübersetzern wissen zwar, dass man zwei Seiten nie in dreißig Minuten übersetzen kann, sie denken jedoch, dass man eine schlechte zweiseitige Übersetzung in dreißig Minuten in eine gute verwandeln kann.
Mein Vorschlag für die Nichtübersetzer aus der ersten Gruppe wäre, ein kleines Experiment durchzuführen, in dem sie einen mittelschweren Text mit vierzig Wörtern übersetzen. Dasselbe Experiment machte ich vor kurzem mit meiner Schwester, die natürlich keine Übersetzerin ist, die aber im Fremd- und Muttersprachenunterricht immer eine ausgezeichnete Schülerin war. Am Ende stellte sie erstaunt fest, dass man sehr viel Zeit braucht, um einen so kurzen Text zu übersetzen – sie brauchte zwanzig Minuten.
Und mein Vorschlag für die Nichtübersetzer aus der zweiten Gruppe lautet: Wenn es so leicht ist, aus einer schlechten eine gute Übersetzung zu zaubern, dann tun Sie es doch selbst. Dabei passen Sie aber auf, dass sie nicht mehr als fünfzehn Minuten pro Seite brauchen.
von Ana Dejanović