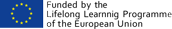Eine Reise durch die Kunst der Übersetzung
Festakt in Kooperation mit der Robert Bosch Stiftung zur Förderung des literarischen Übersetzens an der Universität Tübingen
 Die Rede von Friederike Tappe-Hornbostel (Kulturstiftung des Bundes)
Die Rede von Friederike Tappe-Hornbostel (Kulturstiftung des Bundes)
Ich begrüße Sie im Namen der Kulturstiftung des Bundes.
„Schreibst Du noch oder übersetzt Du schon?“ hat der renommierte Übersetzer Olaf Kühl gefragt, als er seine Antrittsvorlesung für die August-Wilhelm-von Schlegel Gastprofessur zur Poetik der Übersetzung hielt. Damit wollte er die übliche Hierarchie zwischen Schreiben und Übersetzen aufs Korn nehmen. Diese Provokation wird verblassen, davon bin ich überzeugt. Auch das Übersetzungswürfel-Projekt spricht ja davon, dass die Grenzen zwischen Dichtung und Übersetzung verschwimmen. Und mit ihnen wird auch das Profil des Übersetzers immer mehr Unschärfen bekommen. Das ist gut so.
Die Bedeutung des Übersetzens nimmt in unserer sich globalisierenden Welt mit ihren teilweise dramatischen Ursachen und Konsequenzen zu. Dazu kommt, dass die Bedeutung eines literarischen Werkes sich immer stärker nach der Anzahl der Sprachen, in die es übersetzt wird, bemisst. Aber die Anforderungen an Übersetzer werden ebenfalls wachsen: Was heißt es, wenn die Übersetzung eines Werkes beispielsweise ins Deutsche mit einer Leserschaft rechnen muss, die selbst immer kulturell uneindeutiger, gemischter, migrantischer wird? Was heißt es, wenn immer mehr Schriftsteller das sog. Original nicht in ihrer Muttersprache verfassen? Oder wenn sie sich mit Themen aus ihren Herkunftsländern beschäftigen, denen sie sich selbst nur noch als vergleichsweise Fremde nähern können, nämlich durch die Brille ihrer deutschen Akkulturation, wie z.B. Feridun Zaimoglu der Türkei oder Ilija Trojanow Bulgarien? Wer, wenn nicht ein Iranstämmiger deutscher Schriftsteller und Übersetzer aus dem Persischen, Navid Kermani, hätte bei der Verleihung des Friedenspreises eine solch kluge und berührende Rede halten können?
Wird die Tatsache, dass in Zukunft sehr viel mehr Menschen aus dem arabischen Raum in Deutschland leben, die Übersetzung von arabischer (und anderer) Literatur ins Deutsche verändern? Wächst der dichterische Anteil am Übersetzen fast zwangsläufig?
Die Aufgabe, vor der Kultur in diesen Zeiten steht, könnte größer nicht sein. Vielleicht hilft uns das, was derzeit als “Flüchtlingskrise“ wahrgenommen und mehr noch herbeigeredet wird, zu verstehen, welche Hoffnungen an Kultur in anderen Ländern geknüpft werden, in Ländern wie der Ukraine, wo Krieg, Flucht und Migration die Hoffnung auf ein besseres Leben tagtäglich neu herausfordern. Im Gegensatz zu ihnen haben die Flüchtlinge aus Syrien, dem Irak und Afghanistan alle Hoffnung im eigenen Land aufgegeben.
Der ungarische Schriftsteller Attila Bartis, im rumänischen Siebenbürgen beheimatet, und mit seiner Familie vor dem Ceausescu-Regime in den 1980er Jahren nach Budapest geflohen, hat seine Erfahrungen einmal so formuliert: „Nach Meinung vieler Leute gibt einem Hoffnung Kraft, andere hingegen, die schon viel gehofft die nicht nur halbherzig, sondern richtig gehofft haben, wissen, dass es sich gerade umgekehrt verhält: Für die Hoffnung braucht man Kraft. Viel mehr Kraft als für die Hoffnungslosigkeit.“
Übersetzer und Übersetzerinnen sind Kraftspender. Sie erneuern und verkörpern die Hoffnung, dass wir einander verstehen können, so unterschiedlich unseren Erfahrungen, Geschichten und Kulturen auch sein mögen. Und gleichzeitig sind sie auch Experten für das Nicht-Identische. Sie wissen darum, dass es kein 1 zu 1 des Verstehens gibt. Sie wissen darum, dass Übereinstimmung, Identität, ein fast religiöser Wunsch ist.
Historisch völlig nachvollziehbar, hat sich Kultur lange um „Identität“ bemüht und tut es noch immer. Nicht nur das Ringen um eine ukrainische Identität legt davon ein manchmal qualvolles Zeugnis ab. Auch, da, wo die Situation unkritisch ist oder war, spielte „Identität“ eine fundamentale Rolle. Um die Entwicklung einer „europäischen Identität“ ging es, um eine gesamtdeutsche „Identität“ nach der Wiedervereinigung, um nur an zwei aktuellen Beispielen zu zeigen, wie virulent dieses Konzept noch immer ist.
Die Bedrohungsszenarien, die in Deutschland und Europa in diesen Zeiten an die Wände gemalt oder geschmiert werden, zeigen, wie fragil die bisherigen Identitätskonstruktionen sind. Was ist das für eine europäische Identität, in der die Ukraine bisher kaum vorkam? Wie tragfähig ist sie angesichts der jetzigen geopolitischen Umverteilungskämpfe?
In Deutschland war die Gewährung einer doppelten Staatsbürgerschaft für Migranten lange umkämpft, zwei Staatsangehörigkeiten schienen bis vor kurzem mit der Vorstellung von nationaler Identität und gelungener Integration nicht vereinbar. In der modernen Welt, davon wissen die Soziologen ein Lied zu singen, gibt es nur „Identitäten“, verliert das „Wir“ an Differenzqualität gegenüber denen, die vermeintlich nicht dazugehören. Wenn es nicht die Nationalität ist, nicht die gemeinsame Geschichte, keine gemeinsame Religion, wenn die Lebensformen unterschiedlich sind, worin besteht dann Identität? Man kann diesen Begriff nicht unendlich ausweiten. Vielleicht ist er historisch überholt, vielleicht eine der großen Utopien, die bleiben. Was an seine Stelle treten könnte, dafür haben wir jedenfalls noch keine Sprache. Wenn nach Musil Geschichte ein Zug ist, der seine Schienen vor sich herrollt, dann können wir nicht anders als optimistisch sein.
Die Übersetzerinnen und Übersetzer gehören zur Vorhut derer, die auf dem Weg zu einer „Weltkultur“ sind. Mir gefällt das Wort (noch) nicht, es ist auch nur ein Platzhalter. Sie gestalten nicht nur das Futur I, das, was wir morgen lesen werden, sondern auch unser Futur II. Sie gestalten unsere Erinnerungskultur von morgen. Wer werden wir gewesen sein, worauf wird unsere Erinnerung, unser Weltbild, fußen? Identität gibt es nur im Futur zwei, niemals in der Gegenwart. Oder mit den Worten des Soziologen und Philosophen Helmut Plessner gesagt: „Wir haben uns nicht, deshalb werden wir erst.“ Das auszuhalten, dafür braucht man unendlich viel Kraft. Die, und das ist ihnen nicht hoch genug anzurechnen, dürfen wir uns bei ihnen holen.
Mir bleibt hier nur, Ihnen allen zu danken. Für Ihre Unermüdlichkeit, für Ihre Kraft… für alles. Allen voran Frau Schahadat und Frau Dathe, ohne die die Kulturstiftung des Bundes dieses wundervolle und folgenreiche Projekt, den Übersetzungswürfel, nicht hätte fördern können.