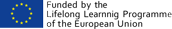“Zinandali” erschien gemeinsam mit anderen Kurzgeschichten 2011 im Band “Chlib i schokolad” (Brot und Schokolade).
Nur einmal im Leben habe ich einen Zinandali getrunken. Und das kam so:
Er kam ohne Klopfen und ohne Grußworte rein. Ein unrasierter Schlauberger mit geröteten Augen. Er trug helle, zerknitterte Hosen, die längst aus der Mode waren. Ich hätte nicht sagen können, wie alt er war – 45 oder 65.
„Ich hab viel von dir gelesen. Deine Artikel sind gut. Du schreibst objektiv. Das schätze ich und möchte dir dafür einen ausgeben“, verkündete er hastig.
„Mh, nein danke. Ich trinke nicht“, murmelte ich.
„Wer trinkt denn schon? Wir wollen uns ja nicht besaufen, sondern einfach ein bisschen beisammen sitzen.“
„Beisammen sitzen? Mein Arbeitstag fängt gerade erst an.“
„Keine Widerrede!“ Er knallte die Hand auf den Tisch. „Sei ein echter Mann, der seines Schreibens würdig ist. Ein Gläschen Wein am Vormittag – das hat doch Tradition in Europa.“
„Vielleicht ein andermal.“
„Du hast mich nicht verstanden. Ich will dich auf meinen Lieblingswein einladen. Georgischer Zinandali, schon mal gehört?“
„Ja. Den hat Stalin gern getrunken.“
„Stalin wusste eben, was gut ist. In jeglicher Hinsicht.“
„Mag sein. Aber ich hab zu tun. Ich muss dringend einen Artikel fertig schreiben.“
„Das ist mir klar, ich will mich auch nicht aufdrängen. Nur ein Gläschen, einen kleinen Schluck. Rein symbolisch, wie man so schön sagt. Auf die Gemeinschaft der Intellektuellen, auf die Verbundenheit im Geiste, auf den Gleichklang der Seelen. Komm schon.“
„Na gut“, gab ich nach, „aber wirklich nur einen kleinen Schluck.“
Er blieb sitzen, hob die Augenbrauen und sagte betreten: „Es gibt da allerdings ein Problem, mein Freund. Momentan hab ich kein Bares. Gib mir eine Arbeit.“
„Wozu?“
„Damit ich Geld für den Wein hab und wir einen kleinen Zinandali trinken können. Er ist wie ein Gebet, wie die Träne einer Nonne. Er riecht nach Veilchen aus dem Alasani-Tal. Ich hab dort mal Vorlesungen gehalten. Gib mir Arbeit, ich bitte dich.“
„Welche Arbeit?“
„Irgendeine.“
„Also gut. Sie können den Hof kehren und den Müll zum Container hinaus bringen.“
„Was? Ich find doch schon öffentliche Toiletten ekelig. Lieber geh ich im Park unter einen Baum. Und du kommst mir mit Müll. Für wen hältst du mich eigentlich?“
„Hm, dann graben Sie bei meiner Schwiegermutter den Garten um und ich bezahle Sie dafür.“
„Mein Lieber, schau dir diese Hände an. Die haben noch nie einen Spaten gehalten und werden es auch nicht tun. Sei mir nicht böse, aber Prinzip ist Prinzip, selbst wenn du es bist.“
„Na vielleicht streichen Sie dann die Wandverkleidung im Korridor der Redaktion?“
„Wohl kaum. Das dauert doch ewig.“
„Gut, dann könnten Sie das Archiv in Ordnung bringen und dort Dokumente in Mappen sortieren?“
„Würde ich liebend gerne tun. Ich hab nichts gegen Arbeit. Aber ich hab was gegen stumpfsinnige Arbeit. Und weißt du, was die Gefahr der Bürokratie ist?“
„Was denn?“
„Gute Frage. Die Gefahr der Bürokratie liegt nicht darin, dass sie das Leben erschwert und Probleme schafft, sondern darin, dass sie Papier hervorbringt. Und beschriebenes Papier zieht Staubklumpen und negative Energie an. Nicht umsonst soll man nach Feng Shui keine Bücher im Haus haben. Chinesische Mönche schreiben deshalb gleich gar nicht auf Papier. Sie tragen Texte mit einem nassen Pinsel auf einen Stein auf und das Wesentliche daraus erhebt sich dann ins Himmelreich… Es bringt nichts, so viel Papier anzuhäufen.“
„Wissen Sie was, Sie müssen gar nichts für mich tun. Hier ist ein Zehner, kaufen Sie sich was zu trinken.“
„Was zu trinken? Du kapierst es einfach nicht. Du glaubst wohl, ich kann mich alleine nicht um die Aufheiterung meiner unsterblichen Seele kümmern!“
„Gar nichts glaube ich.“
„Dann enttäusch mich nicht, Kollege. Nimm dein Scheinchen da zurück. Ich hab dich mit Würde und Pietät angesprochen. Als Produzenten eines gehaltvollen, geistreichen Produkts. Als Meister des Wortes. Und du fertigst mich mit Almosen ab.“
„Okay, ist ja gut. Hier ist noch was. Damit geht sich ein Cabernet oder irgendein Merlot aus, mit dem wir gemeinsam anstoßen können.“
„Irgendein Murlot? Du raubst mir noch den letzten Nerv. Passt schon, dann bin ich halt eine Null, ein nur Unfug labernder Lump. Ich kann auch Spiritus trinken, wär nicht das erste Mal. Aber du – ein Herrscher über Informationen, die Zentralfigur einer Zeitungsrubrik, ein Virtuose des Stils – als ob dir das nicht zu primitiv wär, mit einem verwaisten Penner am helllichten Tage irgendeinen Murlot zu trinken? Was werden deine Kollegen und Untergebenen da sagen? Und wie fühlst du dich danach? Herrgott nochmal, warum wissen Leute wie du nicht, was sie wert sind, warum gönnen sie sich nie etwas? Das wüsste ich gerne. Wenn jemand das Recht auf einen Zinandali hat, dann du, das kannst du mir glauben, mein Guter. Also trinken wir jetzt einen? Wo er dir doch zusteht!“
„Wieviel?“
„Was?“
„Wieviel kostet eine Flasche Zinandali?“
„Achtzig im ‘Zentral’. Drei Hrywnja weniger im Supermarkt. Aber die Marschrutka hin und zurück…“
„Okay. Ich hab einen Hunderter, den wechsle ich schnell.“
„Nicht nötig.“ Hastig fing er den Geldschein ab. „Geräucherter Käse und Mandeln passen hervorragend zum Zinandali. Das hab ich getestet.“
Ich gab mich geschlagen. Ich musste den Artikel fertig schreiben. Der Mann verschwand so unvermittelt und lautlos, wie er aufgetaucht war. Drei Stunden später hatte sich mein Ärger gelegt. Weitere zwei Stunden später begriff ich schließlich, dass ich meinen Hunderter abschreiben konnte. War ja nicht anders zu erwarten.
Gegen Ende des Arbeitstages kam Vira, die Putzfrau, mit einem klappernden Eimer an und sagte: „Da wartet schon länger ein Mann auf Sie. Ich find den recht merkwürdig…“
Dann kam er rein und stellte schweigend eine Tüte auf den Tisch, aus der eine grünliche Flasche mit georgischen Schnörkeln herauslugte. Er war rasiert und ein weißer Schal schmückte seinen Hals.
„Ich bin nicht reingekommen, weil Sie am Schreiben waren“, wechselte er zum „Sie“. „Ich wollte Sie nicht stören.“
Dann schickten wir Vira um einen Korkenzieher. Er öffnete feierlich die Flasche, biss sich dabei auf die Zunge und beobachtete kritisch, wie ich die Häppchen auf einer Zeitung ausbreitete. Schnell tauschte er die Zeitung gegen ein leeres Blatt Papier. Danach tranken wir lange diesen wunderbar zart-säuerlichen Wein und zerrieben harte Mandelkerne zwischen den Zähnen. Wir tranken, sprachen und schwiegen. Manches ließ sich besser bereden, manches besser beschweigen.
Nach einiger Zeit, etwa ein halbes Jahr später, hat mir ein Freund, der Geschäftsführer eines Autohauses, in der Sauna eine ähnliche Geschichte erzählt. Alles war fast so wie bei mir, nur dass sie Hennessy Cognac getrunken haben.
Aus dem Ukrainischen von Nina HAWRYLOW, Wien