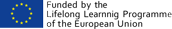Einleitung
Der Roman setzt sich auf eine für den Leser bisweilen schmerzliche Art und Weise mit dem Thema Schuld auseinander. Die Hauptfigur, Vladan Borojević, erfährt als Erwachsener, dass sein totgeglaubter Vater, Nedeljko, ein General der Jugoslawischen Volksarmee, des Genozids angeklagt und deshalb gesucht wird. Für Vladan, der seit seiner Jugend in Ljubljana lebt, beginnt eine beschwerliche Reise zurück zu den Orten seiner Kindheit und seiner Traumata, die er bei Beginn des Krieges und nach dem Einzug seines Vaters in die Armee verlassen musste. Auf der Suche nach dem Vater sieht sich Vladan auch immer mehr mit dessen vermeintlichen Verbrechen konfrontiert. Dies geht so weit, dass aus der Suche nach dem Vater eine qualvolle Suche nach Aufrechterhaltung der persönlichen Integrität wird. Der übersetzte Auszug ist ein Schlüsselmoment, in welchem beschrieben wird, wie Vladan äußere und innere Grenzen überwindet. Äußerlich fährt er über die Grenze von Kroatien nach Serbien – eine Grenze, die es zu Zeiten seiner Kindheit noch nicht gab – und innerlich öffnet er dem Gedanken, dass sein Vater wirklich ein Kriegsverbrecher sein könnte, die Schranken.
Ein Interview mit dem Autor finden Sie hier.
[…]
»Du kommst von Novi Sad?«
»Ja.«
»Und wie ist es dort jetzt?«
»O.k.«
»Mann, war das damals eine schöne Stadt. Gehen die Leute dort immer noch an der Donau
spazieren?«
»Ich denke schon.«
»Einen Scheiß gehen sie spazieren. Wenn du wüsstest, was für eine schöne Stadt das war. Herrlich. Und was für Mädchen. Solche gibt’s da jetzt sicher nicht mehr. All das ist jetzt vorbei. Aber damals! Ich krieg noch heute einen Steifen, wenn ich die Donau im Fernsehen sehe. Was da damals alles spazieren ging, wenn du wüsstest, Vladan. Das gibt‘s nirgends mehr. Nicht einmal in Amerika.«
Er gab mir meinen Reisepass zurück, aber ich war nicht überzeugt, dass es angemessen gewesen wäre, ihn während dieses Sevdah-Moments, dieses melancholischen Augenblicks, allein zu lassen. Dann schaffte er es aber doch, mir ein Handzeichen zu geben, dass ich weiterfahren und die Staatsgrenze wieder öffnen soll. Was ich auch gern getan hätte, wenn die Karre nicht genau dann entschieden hätte, ein wenig zu streiken, was auch den Zöllner aus seinen feuchten Träumen von Novi Sad zurück in die Rolle des Verteidigers »Unserer schönen Heimat[1]« holte.
»Was ist jetzt?!«
Zum Glück erfasste meine Karre den Ernst der Lage und rettete uns vor der postnostalgischen Angriffslust des Schürzenjägers vom linken Ufer der Donau, die, so schien es mir, grausam und unerbittlich sein konnte. Ich weiß nicht warum, aber ich habe mich schon immer vor Leuten gefürchtet, die sich auf diese Art und Weise ihren Gefühlen hingaben. Es kam mir vor, als wären genau solche Balkan-Softies, jene auf den ersten Blick »echten Kerle« mit ihren Liedern, die sie jeden Augenblick zu Tränen rühren können, die gefährlichste aller Raubtierarten, die in diesem unwirtlichen Lebensraum zu finden sind. In meiner Phantasie waren diese Lieder-Kerle fähig, Gräueltaten zu begehen, die sich emotional weniger hitzige Subjekte nicht einmal erdenken konnten. Ich konnte mir indes lebhaft vorstellen, wie ein Mensch, der besagtem Zöllner aufs Haar gleicht, zu den Klängen der Tamburizzas sanft »Berührt mein Flachland nicht« jault und dabei ein dreizehnjähriges Mädchen aus Novi Sad vergewaltigt, als wäre es aus irgendeinem Grund auf der Welt schuld daran, dass er nicht mehr Arm in Arm mit dessen volljährigen Mitbürgerinnen die Donau entlang spazieren gehen kann.
Ich hatte einmal versucht, diese lebensgefährliche Gefühlslage Nadja zu beschreiben. Zu diesem Zweck hatte ich sie die »infantile Balkan-Empfindung« genannt und sie als eine bedeutende Zutat im unausgewogenen brüderlichen Gemetzel, das sich hierherum wie ein Ritual alle fünfzig Jahre vollzieht, identifiziert. Die Idee des letzten aus einer Reihe hiesiger Genozide, hatte ich ihr erklärt, sei vielleicht wirklich kaltblütig und monströs durchdacht gewesen, bei der eigentlichen Ausführung jedoch seien die Hobbyschlächter ohne Zweifel der Reihe nach der »Sevdah-Empfindung« verfallen und hätten zu den Klängen der Harmonika gleichzeitig Gläser und Köpfe zerschlagen.
Ich zumindest habe mir die balkanischen Mörder schon seit langer Zeit so vorgestellt. Sie sind für mich nie seelisch tote Vollstrecker fremder Befehle gewesen. Nein, in meinen Ängsten waren sie eine durchschwitzte, besoffene Kumpanei, die während der Peinigung der Gefangenen zu denselben wunderschönen Liedern »abging«, zu denen sich einst ihre Opfer verliebt und geheiratet hatten. Das war für mich nun mal das Gleichnis des Krieges in Bosnien, ein großer »Sevdah nightmare«, eine einzige Blutorgie des Seelenschmerzes. Die Rache unglücklich verliebter und ewig unreifer Verrückter. »Böse Menschen haben keine Lieder[2]« dachten sich vermutlich diese uniformierten Halbwüchsigen, während sie über das Schlachten und das Werfen in Gruben sangen und sich dabei umarmten, küssten und voreinander ihre empfindsamen Balkanseelen öffneten. Alles war nur ein einziges Leiden und Trauern übermäßig sentimentaler Neandertaler.
***
»Weißt du, er hatte niemanden außer dir und Duša. Als man ihm euch wegnahm, ist für ihn die ganze Welt zusammengebrochen.«
Ich wusste nicht, wer ihm uns weggenommen haben soll, und hatte den Verdacht, dass dies noch eine der Verschwörungen gegen die Serben und Serbien war, aber das, worüber Danilo geredet hatte, erschreckte mich dennoch ein wenig. Es kam nämlich einem stillen und schlecht verborgenen Geständnis nahe, wonach die Möglichkeit bestand, dass Nedeljko doch etwas von dem getan hatte, weswegen er verfolgt wurde. Und zugleich einer Rechtfertigung dessen.
Ich fuhr, wie passend, am Erinnerungsort für die Gefallenen der Syrmischen Front vorbei, und plötzlich schoss es mir durch den Kopf, dass vielleicht auch Nedeljko einer jener psychopathischen Sensibelchen war, die bewaffnet mit einem Bataillon Irrer unter ihrem Kommando überall nur ihre Henker sahen. Vielleicht hatte auch ihm der unerträgliche Schmerz wegen des Zerfalls seiner Familie in einem Moment den Verstand so sehr getrübt, dass er diesem Schmerz nur noch gehorsam auf dessen mörderischem Rachefeldzug folgte.
Und auf einmal schien es mir nicht mehr so überaus unwahrscheinlich, dass mein Vater ein Dorf voller Frauen und Kinder dem Erdboden gleich gemacht haben soll. Ich sah ihn, wie er mit Tränen in den Augen dem Wüten seiner Soldaten zusieht und dabei den unmenschlichen Schreien der zum Tod Verurteilten zuhört, als wären sie die wehmütige Stimme von Toma Zdravković, und wie sie ihn nicht um Hilfe rufen können, weil sie lediglich seine emotionale Hypnose vertiefen. Womöglich sah Nedeljko wirklich, wie lebendige Menschen brannten, wie Mütter dem Sterben ihrer eigenen Kinder zusahen und wie bartlose Soldaten bucklige Greise abschlachteten, aber er konnte sich nicht mehr aus der vorübergehenden Unzurechnungsfähigkeit herausreißen. Er versank im schmerzlichen Gefühl, ausgespielt, ausgeliefert und betrogen zu sein, und er säte Tod, um dieses Leben zu bestrafen, das ihm alles genommen hatte, was ihm lieb war. Er war ein betrogener Liebhaber, Ehemann und Vater auf der Jagd nach dem Mörder seines Glücks. Womöglich wollte Nedeljko Borojević in jener slawonischen Nacht in Višnjići diesen verfluchten Krieg erschlagen, ihn zerstückeln, ihn in Brand setzen, ihn quälen, ihn zerfleischen, ihn schlachten, ihn vierteilen und pfählen. Er wollte alles vernichten, was zum Krieg geführte hatte und auch alle, die ihn sich wünschten, die ihn herbeisehnten, die ihn sich erträumten. Er wollte jene töten, die hassten, die hetzten, die zum Tod aufriefen. All das tötete und brannte Nedeljko in jener Nacht womöglich nieder.
Wer weiß, wann Nedeljko Borojević und ob er überhaupt jemals ganz aus diesem Wahn erwacht ist und blutbefleckt festgestellt hat, dass er anstelle des Krieges nur vierunddreißig völlig unschuldige Menschen getötet hatte. Und dass sich der Krieg, während sein Feuer im niedergemetzelten Dorf langsam erlosch, nur noch weiter entflammt hatte und unaufhaltsam über die Sava ergoss.
Einleitung und Übersetzung aus dem Slowenischen von Franziska MAZI, Basel.
Quelle: Jugoslavija, moja dežela / Goran Vojnović. © Študentska založba 2012