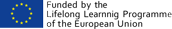Gulasz z turula (Turulgulasch)
Auszug aus dem Essayband „Gulasz z turula“ (dt. „Turulgulasch“, Verlag Czarne 2008, S. 100-104).
Mit Gulasz z turula unternimmt der polnische Romancier und Essayist Krzysztof Varga einen Streifzug durch Ungarn, das Land seines Vaters. Wie schon der Titel des Buches verrät, spielen dabei vor allem zwei Dinge eine große Rolle: die vom Sagenvogel Turul verkörperte ungarische Geschichte, die wie ein schweres Netz auf der Gegenwart des Landes lastet, und die ungarische Küche, die den Autor zu nostalgisch anmutenden Anekdoten und philosophischen Überlegungen zur Seelenlage der Nation anregt. Mit Begeisterung berichtet Varga von alten Straßenbahnen, die Geschichten erzählen und in die Vororte Budapests führen, zu idyllischen Friedhöfen, zu abgelegenen Kneipen, manchmal auch zur eigenen Jugend. Doch auch kritische Betrachtungen zu gesellschaftlichen und politischen Zuständen finden ihren Platz in diesem Buch, so dass ein differenziertes Bild des heutigen Ungarn entsteht.
Abends, gegen neunzehn Uhr, bringen sie frische Karpfen in die Markthalle am Csarnok tér. Auf einer großen Ladefläche stehen Plastiktonnen, ein Mann in hohen Gummistiefeln zieht dicke, zappelnde Fische heraus und legt sie in die Ablaufrinne, von wo aus sie direkt in einen Einkaufswagen rutschen, der von einem zweiten Mann in graugrünem Gummi-Overall geschoben wird. Die beiden sind mit Elan bei der Sache, so, als sei dies die Vorbereitung auf ein Städteturnier, bei dem Karpfenausladen eine der Disziplinen wäre. Wenn der Wagen fast voll ist, schließt der erste Mann schwungvoll die Rinnentür, der zweite bringt die Karpfen ins Lager. Manchmal springt einer der etwas energischeren Karpfen aus dem Wagen oder aus der Rinne und fällt auf den Asphalt, und dann zappelt er um den Gully herum, der das aus den Tonnen überschwappende Wasser aufnimmt. Nun taucht ein dritter Mann auf, der bis zu diesem Moment die Entladung vom Rand her beobachtet hat, und versucht, den glitschigen Fisch zu packen. Die beiden anderen nehmen von dem, was mit dem Fisch auf dem Asphalt geschieht, keinerlei Notiz, sondern entladen weiter Karpfen, von denen es Unmengen gibt. Beim dritten Versuch schafft es der Hilfsmann dann doch; er wirft den Fisch in den Korb. Der Karpfen ist der Mythologie zufolge neben dem Turul und dem Wunderhirsch der Dritte, der die Ungarn in ihr Land geführt hat, ein heiliges Tier, Opferlamm der magyarischen Küche, das seinen dicken, schlammigen Körper für die berühmte Fischsuppe hingibt, nach der ausländische Touristen fragen, während sie auf die kulinarischen Seiten ihres Reiseführers schielen.
Am späten Abend schlendern auf der Váci utca – einst der sozialistische Ersatz für westlichen Konsum und heute eine gewöhnliche Straße, auf der Touristen übers Ohr gehauen werden – Amateurhuren und Koberer der Nachtclubs. Die Geschäfte mit ungarischem Zeug in hübschen Verpackungen und die Wechselstuben mit Wucherkursen sind schon geschlossen und die Váci verliert endgültig ihren trügerischen Großstadtschein. Die Straße wird sehr provinziell, wie eine Grenzstadt, in der um diese Uhrzeit nur noch der McDonald’s und die Tabledance-Bar geöffnet sind. Die Huren sind schüchtern und bescheiden gekleidet. Sie tragen weder Pelz noch Stöckelschuhe, sind nicht aufdringlich geschminkt, sehen eher aus wie Verkäuferinnen, denen auf dem Nachhauseweg in den Sinn kam, noch ein bisschen auf der Váci zu schlendern. Sie sind auf der Suche nach Ausländern und fragen diese zunächst, ob sie englisch sprechen, und auf ein Ja folgt eine Testfrage, zum Beispiel nach der Régi Posta-Straße, die jeder Budapester kennt, aber kein Ausländer. Sie erinnern an die Filmheldinnen aus Süße Emma, liebe Böbe von István Szabó: zwei junge Russischlehrerinnen, die nach 1990 plötzlich arbeitslos sind. Emma versuchte Englisch zu unterrichten, obwohl sie es selbst gar nicht konnte, Böbe hingegen wollte eine Abkürzung nehmen und saß fortan im Café „Anna“ auf der Váci, um Ausländer aufzureißen. Keine von beiden schaffte es: Emma landete in einer Unterführung, wo sie die „Mai Nap“ verkaufte, und Böbe im Hof eines Studentenwohnheims, aus dessen Fenster sie gesprungen war. „Mai Nap“ bedeutet „der heutige Tag“, und der Name der Zeitung ist deutlich symbolisch gemeint – der heutige Tag des frühkapitalistischen Ungarns in Szabós Film heißt ungerechte Strafen für Menschen, die man zufällig für Profiteure des vergangenen Systems halten konnte, bloß weil sie Schülern die verabscheute Sprache der sowjetischen Besatzer beibrachten.
Die heutigen Emmas und Böbes wirken deutlich weniger verzweifelt. Sie sind dilettantisch, aber nicht verspannt. Sie sprechen ihre Kunden an, als ginge es ihnen gar nicht ums Geld, sondern als böten sie ihre Dienste aus Barmherzigkeit an. Schließlich können viele Männer an langen, einsamen Herbstabenden ein wenig Trost gut gebrauchen. Die leichten Mädchen auf der Vácistraße sind nicht blasiert und haben noch keine Routine, ihr Gewerbe betreiben sie ein bisschen verschämt und wirken dadurch irgendwie sympathisch.
Samstags findet auf dem Rasen vor dem Lukács-Bad der óckapiac statt – ein Trödelmarkt, zusammengetragen aus aufgelesenem Müll, alten Möbeln und Haushaltsgegenständen vom Sperrmüll, den ungewollten Resten fremder Leben. Man kann hier allen möglichen Kram bekommen: alte, von krummen Füßen abgetragene Schuhe, Lappen, die vorgeben, Kleider zu sein, hässliches Plastikspielzeug, stumpfe Messer – dieses schmutzige, verstaubte Zeug umwirbt plump seine potenziellen Käufer. Billig gibt es hier auch von Fremden abgenutztes Glück zu kaufen. An einem Stand in Form einer auf der Wiese ausgebreiteten Decke bietet eine ältere Frau für zwanzig Forint das gerahmte Foto eines lächelnden Paares feil; sie um die dreißig, Blondine mit gelocktem Haar, er sicher zehn Jahre älter, bärtig, mit ungewöhnlich großen Geheimratsecken. Sie knackig, er sehnig, beide wirken gesund und sportlich. Sie sitzt auf seinem Schoß, das Lächeln der beiden ist ehrlich, im Hintergrund sind Sträucher zu sehen und eine Garten- oder Campinglampe. Das blasse Kolorit lässt auf den Gebrauch eines ORWO-Films schließen, der Schnitt der sommerlichen Kleidung auf die späten Siebziger, vielleicht Achtziger. Die Frau, die das Bild verkauft, muss es auf dem Sperrmüll gefunden haben. Wer entledigte sich erleichtert dieses Beweisstücks einer früheren Freundschaft oder Liebe? Der bärtige Typ? Die Blondine? Ein Dritter? Eines ihrer Kinder oder ein Bekannter? Stand es zu Hause im Weg, war seinetwegen kein Platz für den neuen Spiegel? Es ist ein großes Foto, anders als jene, die in Pralinenschachteln verwahrt werden. Es beansprucht ein beträchtliches Stück Wand. Wie kommt die Verkäuferin überhaupt darauf, dass es jemand kaufen könnte? Es hat keinerlei Gebrauchswert, auf dem Bild sind anonyme Menschen verewigt, keine bekannten Leute aus dem Fernsehen oder den bunten Blättern, keine Schauspieler, keine berühmten Sportler, sondern, sagen wir mal, Zsussa und János aus den Wohnblocks von Obuda oder aus den Mietshäusern der nahegelegenen Margit körút. Es ist nicht teuer, kostet so viel wie ein Glas Bier in einer dunklen Spelunke – doch wen wird es schon zum Kauf verleiten?
„Lomtalanítas“ bedeutet „Sperrmüll“, Entsorgung von Gerümpel im großen Stil. Die Bezirke wechseln sich mit diesem Feiertag des überflüssigen Plunders ab, weswegen nicht gleich die ganze Stadt in eine große Müllkippe verwandelt wird. An diesem feststehenden Tag stellen die Bewohner alte Schränke, Betten, Matratzen mit herausstehenden Federn, von Motten zerfressene Mäntel, kaputte Waschmaschinen und Kühlschränke auf den Gehweg vor ihren Häusern. Im Trümmerhaufen von Holz und Metall kann man dann alte Bildbände, von Grünspan überzogene Romane, Poesiealben junger Leute und Klassenbilder von längst nicht mehr lebenden Menschen aufstöbern – vielleicht ist auch eine der beiden Personen vom Zwanzig-Forint-Bild schon tot?
Wenn der lomtalanítás naht, kann man ungestraft all das auf die Straße werfen, was nicht mehr gebraucht wird, dem Leben im Weg steht, unpraktisch oder kaputt ist, aber auch Dinge, die in uns Erinnerungen wachrufen, uns mit der Vergangenheit verbinden, von der wir uns befreien wollen wie von einem lästigen Verehrer, der uns mit Briefen und Anrufen nachstellt. Während des lomtalanítás versperren auseinandergebrochene Schrankwände aus den Sechzigern, vergilbte Lehel-Kühlschränke und Hajdú-Waschmaschinen mit ausgerissenen Bullaugen, alte sowjetische Rakieta-Staubsauger, große Plastiktelefone mit runden Wählscheiben und eigenwillige alte Lampenschirme die Gehwege. Mit dem lomtalanítás wird Budapest noch melancholischer, zeigt sein Innerstes, entrümpelt sein Gedächtnis.
Einleitung und Übersetzung aus dem Polnischen von Melanie FOIK, Münster