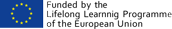Alena ZEMANČÍKOVÁ: Wie ein Obdachloser
„Kein Besitz“, verkündete meine Mutter radikal, während sie das von Großmutter geerbte massive Goldarmband in Seidenpapier wickelte. Für die Zimmerwirtin aus der Bezirksstadt, wohin sie sich aus der Kreisstadt aufmachte, der Arbeit wegen. „Gut, dass wir nichts haben, dann hält uns hier wenigstens nichts, und so eine Geschmacklosigkeit würde ich sowieso nicht tragen“, das war an die Adresse des massiven Schmucks gerichtet, dessen Durchmesser das zarte Handgelenk meiner Mutter um das Doppelte übertraf. Sie verkaufte das Armband unter Wert, damit wir in jener Kreisstadt beide zur Untermiete wohnen konnten, wenn ich ab September das Gymnasium besuchen würde, nachdem man mich in unserem Städtchen nicht genommen hatte. Der letzte Kommilitone meiner Mutter war in dieser Stadt Leiter der Bibliothek und hatte ihr eine Stelle angeboten; gerade als sie diese antrat, war man dabei, ihn seiner Funktion zu entheben. Wir lebten zwei Tage zur Untermiete, bis ich etwas anstellte, wofür uns unsere Wirtin hinauswarf aus dieser Wohnung voller Kristallglas und Porzellan, goldgerahmter Bilder und Perserteppiche: Ich hatte mich überall dahin geschlichen, wohin es verboten war, alles hatte ich geöffnet, durchgesehen, probiert – Sie hatte mir Fallen gestellt und alles bemerkt. Heute überallhin zu schleichen hieß morgen etwas zu stehlen, „Frau Doktor, Sie hätte ich hier sehr gerne, aber, nehmen Sie es mir nicht übel, das Mädchen will ich hier nicht und die Bücher können Sie auch mitnehmen.“ Vor dem Haus sagte meine Mutter: „Hier hätten wir es nicht ausgehalten, nur ums Armband tut es mir leid, es war aus Gold.“
Meine Tante Anna, eine hochgewachsene Frau von kräftiger Statur, der das Armband gut gestanden hätte, lebte in Prag in einer Wohnung zusammen mit meiner Großmutter. Sie hatte Sprachen studiert, wie man damals sagte, und bei Čedok gearbeitet. Sie war um einiges früher rausgeschmissen worden als meine Mutter aus dem Kulturzentrum der Grenzstadt, bereits in den fünfziger Jahren, als man ihren Mann eingesperrt hatte. Dieser Onkel war ein Autokenner und eine Händlernatur, in unsere – in Großmutters – Familie passte er nicht allzu sehr: Er las die Motorwelt, und diese Welt war eine völlig andere. Er musste eine Art Abenteurer sein, denn auf dem Schuhschrank im Vorraum standen Siegerpokale von Autorennen, allerdings war in jener besagten Zeit in unserer Umgebung nirgendwo ein Rennen in auch nur einer seiner Disziplinen veranstaltet worden. Ich dachte, wir wären für ihn zu unkonventionell, aber wahrscheinlich mochte er uns deshalb nicht, weil meine Mutter in der kommunistischen Partei war. In der Prager Wohnung gab es zwei Welten, und meine Tante wechselte zwischen ihnen hin und her. Die Welt des Onkels hinter der Tür zu seinem Zimmer, dort gab es einen Fernseher, stapelweise Automagazine und ihn selbst – ein angegrauter Elegant, der mir unterstellte, ihn nicht zu grüßen. Die Welt der Großmutter in Küche und Esszimmer, mit dem Radio und einem zerlesenen Buch auf dem Nachttisch. Die Jahre im Gefängnis trug sie dem Onkel eigenartigerweise nach, ihrer Meinung nach hatte er meiner Tante Leben und Beruf verdorben mit seinen törichten Geschäften. Alle Brüder meiner Großmutter waren Handwerker gewesen, sie selbst Angestellte bei einer Bank, bevor sie meinen Großvater heiratete, ebendort beschäftigt, und Hausfrau wurde, wie es sich damals gehörte. Die Welt der Finanzen kannte sie gut, die Welt des Handels war ihr fremd. Über alles aber ging ihr die Welt der Familie, und deshalb verstand sie sich so gut mit Onkels Schwester Olga.
„Besitz ist nur eine Last“, sagte Olga, als ihr älterer Sohn, dem sie für einen Kredit gebürgt hatte, sie im Jahr 1968 in finanzielle Not brachte. Er war mit diesem Geld emigriert und hatte ihr die Rückzahlung überlassen. Sie lebte in einer dunklen Pawlatschen-Wohnung in den Prager Weinbergen. Mir kam es so vor, wenn ich mit der Großmutter dort zu Besuch war, als hätte die Wohnung keine Fenster, die Toilette war draußen auf der Pawlatsche, der Herd im Vorraum. Doch immer wenn wir Olga besuchten, gab es Schnittchen, wie man sie in unserer Grenzgegend nirgendwo zu Gesicht bekam. Olga hatte einen Boxer und zwei erwachsene Söhne, aber die wohnten woanders. Nichts in dieser Wohnung oder an ihrer Bewohnerin zeugte von Reichtum oder Besitz, ganz im Gegenteil. Dabei war Olga einst mit einem reichen Finanzier und Fabrikbesitzer verheiratet gewesen. Der starb gleich nach 1945, wie mein Großvater auch, nur dass mein gutsituierter Großvater ein Bankbeamter gewesen war, Olgas Ehemann hingegen Bankier. Während Großvater eine schön eingerichtete Wohnung in Prag hinterließ, hinterließ Olgas Ehemann einige Häuser und die Fabrik. Den Februar 1948 erlebte Olga als junge Witwe mit zwei Kindern, man nahm ihr alles, beschuldigte sie der Mithilfe bei illegalem Grenzübertritt in mehreren Fällen und behielt sie zwei Jahre lang in Untersuchungshaft im Pankrácer Gefängnis. Als man sie entließ und die Kinder aus dem Heim zur Mutter zurückkehrten, lebte in ihrer Luxuswohnung voller Teppiche, massiv gerahmter Bilder, Kristallglas und Porzellan ein fremder Mann. Olga, der keine Schuld nachgewiesen werden konnte als die, einen Bankier geheiratet zu haben, forderte ihren Hausrat vor Gericht ein und gewann. Um den Geheimdienstler in ihrer Wohnung vor einem allzu plötzlichen Totalverlust zu verschonen, wurde entschieden, dass er ihr die Sachen – zumindest das, was er nicht leugnen konnte – abkaufen und bezahlen würde. Zu je hundert Kronen im Monat. Olga kam an jedem Dritten des Monats und klingelte an seiner Tür, der Geheimdienstler war nie zu Hause, dann stellte man ihr Telefon ab, schließlich war das Haus unten abgeschlossen, nach einem Jahr gab sie es auf.
(OT Jako bezdomovec. Aus: Zemančíková, Alena: Bez otce. Povídky z let 1991-2007. Erschienen bei Mladá fronta, Praha 2008. S. 108-111)
Aus dem Tschechischen von Daniela PUSCH