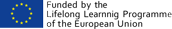Interview mit Andreas Tretner in Berlin
Interview mit Andreas Tretner in Berlin
Foto © Renate von Mangoldt, Literarisches Colloquium Berlin.
1. D.P.: Welche Stationen Ihres Werdeganges waren für Sie wichtig?
A.T.: Ach, dass hat irgendwie alles seine Logik. Das Literaturübersetzen hat mich schon früh interessiert. Aber das Sprachmittlerstudium in Leipzig war damals streng funktional ausgerichtet und ideologisiert. Literatur war nicht vorgesehen und daher private Sache, Eigeninitiative: Wir haben uns abends bei einer Lehrerin zu Hause getroffen und Zoščenko übersetzt. Die vier Jahre als Industrieübersetzer waren wiederum sehr nützlich für die Fähigkeit, sich in technische Vorgänge einzudenken. Die Frage, ob eine Tür nach innen oder außen aufgeht, kann nicht nur in einem Krimi wichtig sein … Und während meiner Jahre als Lektor für osteuropäische Literatur bei Reclam Leipzig habe ich den analytisch-rezeptiven Blick entwickeln können: Was unterscheidet eine gute von einer schlechten Übersetzung? Das hilft mir heute sehr. Kurzum: Ins Literaturübersetzen kann man gut quer einsteigen, und der gerade Weg ist nicht unbedingt der beste.
2. D.P.: Sie übersetzen aus drei Sprachen. Wie ist der Anteil der Übersetzungen aus dem Tschechischen im Verhältnis zu denen aus dem Bulgarischen und aus dem Russischen?
A.T.: Eingestiegen bin ich mit Kurzgeschichten des bulgarischen Autors Jordan Radičkov, über den ich meine Diplomarbeit geschrieben hatte. Das Interesse hier an bulgarischer Literatur ist leider nicht sehr groß. Am meisten übersetze ich aus dem Russischen, aus dem Tschechischen bislang am wenigsten. Das Tschechische war für mich während des Studiums eine Freizeitfreude. Mein Freund Wolfgang Spitzbardt hat mich da hineingeführt anhand der wunderbaren „Malé recenze“ von Skácel. Aber bis heute ist es mir leider nicht gelungen, eine längere Zeit im Land zu verbringen, das Tschechische ist reine Lesesprache geblieben. So habe ich mich auf ein Experiment eingelassen, als Eckhard Thiele mir seinerzeit anbot, „Bassaxofon“ von Josef Škvorecký zu übersetzen – vielleicht weil er von meiner Vorliebe für den Jazz wusste. Diese Arbeit hat mir gezeigt, wie weit man auch mit nur passiver Sprachbeherrschung kommen kann, wenn man die nötige Akribie aufbringt. Man entwickelt ein anders geartetes Rezeptorium, als wenn man in einer Sprache „zuhause“ ist. Das „Bassaxofon“ ist mir bis heute sehr nahe, gemeinsam mit der Saxophonistin Almut Schlichting haben wir daraus eine Art Partitur erarbeitet und treten auf damit. Auf der Bühne spüre ich besonders, wie sehr Sprache Rhythmus ist. Mittlerweile bin ich da sehr empfindlich, wenn im Text etwas rhythmisch nicht stimmt.
3. D.P.: Sind Sie als Übersetzer lieber sichtbar oder unsichtbar?
A.T.: Was die Sichtbarkeit im Literaturbetrieb angeht, so hat sich da in den letzten Jahren etwas getan – nämlich weil wir Übersetzer viel dafür getan haben. In Buchrezensionen, gerade auch bei Neuübersetzungen, wird unser Tun nun häufiger ins Auge gefasst. Ganz abgesehen von „Homestories“ über Kollegen in den Medien oder Interviews wie diesem. Darum bin ich in dem Punkt heute entspannter, reagiere nicht mehr so empfindlich, wenn ich als Übersetzer bei einer Rezension mal nicht erwähnt werde. Mir ist einfach klargeworden, welch heikle Rolle der Übersetzer in der Beziehung zwischen Autor und Leser spielt. Kollege Jürg Laederach hat das mal so beschrieben: Der Autor ist das Idol, dem – und seiner Aura – der Leser ganz nahe sein will. Er möchte, dass der Autor nur zu ihm spricht. Wenn sich da noch ein Übersetzer „reinhängt“ und um Aufmerksamkeit heischt, fühlt der Leser sich gestört – was will der denn? Der Leser möchte sich der Illusion hingeben können, mit dem Autor ganz alleine zu sein.
4. D.P.: Und die Sichtbarkeit im Text? Haben Sie eine „Handschrift“?
A.T.: Theoretisch herrschte hier die gleiche Maxime: Wenn das Buch schon übersetzt werden muss, dann bitte so, dass ich, der Leser, nichts davon mitkriege. Aber das geht leider nicht. Aus der Physik wissen wir: Es gibt keinen reibungslosen Raum. Ein Literaturübersetzer kann seine Subjektivität nicht auflösen, selbst wenn er es wollte. Er trifft ästhetische Entscheidungen. Stellen Sie sich den Übersetzer also besser als Interpreten vor, wie wir ihn aus der Musik oder dem Theater kennen. Demnach ist der Autor der Komponist, sein Text wird „gespielt“, ausgelegt und inszeniert, die Übersetzung wäre dann eine Aufführung. Der Interpret hat eine Handschrift, aber sie muss flexibel und von Fall zu Fall angemessen sein. Chopin, wenn er von Lang Lang gespielt wird, wird unverwechselbar Lang Lang sein – aber er sollte sich nicht genauso wie sein Bach anhören.
Dann gibt es natürlich noch die Grundfrage des Übersetzens, wie weit man einen fremden Autor überhaupt in die eigene Sprache holt. Ich bin kein Freund davon, im Text „das Tschechische“ oder „das Russische“ an sich zu bewahren. So klar, wie der Originaltext seinem Leser entgegentritt, so klar sollte die Übersetzung auf den deutschen Leser zukommen. Ich weiß, dass nicht alle so denken – wenn man so will, gehört das zu meiner Handschrift.
5. D.P.: Was macht Ihnen beim Übersetzen besonders Spaß? Was bereitet Ihnen Mühe?
A.T.: Beides, Kampf und Lust, erlebe ich jedes Mal wieder. Das ist ein unvermeidlicher Zyklus. Der größte Kampf findet zu Beginn einer Übersetzung statt. Ich stecke vielleicht noch in dem Text, den ich vorher übersetzt habe, bin noch in der Sprache dieses Autors gefangen. Bevor ich mich davon befreit habe, kommt das Gefühl auf: nichts geht. Es gilt erst einmal, die Sprache des neuen Autors zu erfinden, mit den eigenen Mitteln zu generieren, bis ein erkennbarer Ton entsteht. Bis es soweit ist, muss ich durch die Wüste, das kann bis zur vorübergehenden Verstummung gehen. Das muss ich einplanen. Aber dann, irgendwann, merke ich: Ich bin drin! Der Spaß kommt also mit der Zeit.
6. D.P.: Wie bewerten Sie den deutschen Buchmarkt?
A.T.: Wie derzeit so vieles, steckt auch der Buchmarkt in einer Krise. Die Stimmung schwankt zwischen Hysterie und Lethargie. Die Verlage sind in der Situation, sich selbst in Frage stellen zu müssen, ganz neue Strategien zu entwickeln. Denn das Verhältnis der Menschen zum Buch einerseits, und wie es zum anderen entsteht und beschaffen ist, das alles ändert sich gewaltig. Wohin das geht, lässt sich noch nicht absehen. Wie ein Schiff im Sturm, tja, wie bewerte ich ein Schiff im Sturm? Um es mal auf einen sarkastisch-tröstlichen Punkt zu bringen: Verlage, wie wir sie kennen, können sich weniger sicher sein als Übersetzer, ob sie für die literarische Kommunikation der nahenden Zukunft überhaupt noch benötigt werden.
Die osteuropäische Literatur ist auf unserem Buchmarkt prekäre Zustände gewohnt, aber auch hier schlägt die Krise durch. Nehmen wir unsere Übersetzung von Jáchym Topols „Kloktat dehet“ („Zirkuszone“): Spitzenverlag, eingeführter Autor, beste Rezensionen, um die 700mal verkauft. Da hat sich die Durchschnittsauflage in zehn Jahren mindestens halbiert, so etwas lässt sich kaum noch kalkulieren. Andererseits entstehen neue Fördermöglichkeiten etwa durch Stiftungen. Da ist in erster Linie die Robert Bosch-Stiftung zu nennen, denen fällt unerhört viel ein. Man denke an die „Tschechische Bibliothek“, dieses Wunderwerk. Ich wünschte, es gäbe auch eine „Bulgarische Bibliothek“… Die Russen sind übrigens auch endlich drauf gekommen, dass sie für die Übersetzung ihrer Literatur in die Sprachen der Welt selbst aktiv werden müssen.
7. D.P.: Was raten Sie jungen, angehenden Übersetzern?
A.T.: Wenn ich mich auf einen unoriginellen Tipp beschränken darf: Lesen! Viel lesen, und zwar in beiden Sprachen, mehr noch in der eigenen. Damit meine ich ein durchaus empathisches Lesen, das vor der Analyse aber nicht scheut, etwa im Hinblick darauf, was einen Stil ausmacht. Das Deutsche hat so viele Möglichkeiten, nur ein kleiner Teil wird im Alltag aktiv gebraucht. Was ich heute bei Jean Paul oder Clemens Setz gesehen und begriffen habe, kann ich morgen plötzlich bei Sorokin oder Šrut anwenden. Sei es ein syntaktischer Dreh, sei es ein schlichtes Wort. Und das gilt eben leider auch umgekehrt. Wie Johnny Cash das mal gesagt hat: “Style is a function of your limitations, more so than a function of your skills.” Für einen Übersetzer ist es halt keine Option, alles immer nur in drei Griffen zu übersetzen.
von Daniela Pusch
Relying on the structure and methodology of classical and postclassical [...]
Organizer: Research Programme Intercultural Literary Studies / Programska skupina Mednarodne [...]
Relying on the structure and methodology of classical and postclassical [...]
Organizer: Research Programme Intercultural Literary Studies / Programska skupina Mednarodne [...]
Star & TransStar: Ulrike Almut Sandig (Berlin) und Hryhorij Semenchuk [...]
Im Rahmen des Projekts Übersetzungswürfel entstanden fünf kurze Filme mit [...]
Erschienen als Beitrag zum Projekt “Übersetzungswürfel – Sechs Seiten europäischer [...]
Star & TransStar: Ulrike Almut Sandig (Berlin) und Hryhorij Semenchuk [...]
Im Rahmen des Projekts Übersetzungswürfel entstanden fünf kurze Filme mit [...]
Erschienen als Beitrag zum Projekt “Übersetzungswürfel – Sechs Seiten europäischer [...]
Eine Reise durch die Kunst der Übersetzung Festakt in Kooperation [...]
Eine Reise durch die Kunst der Übersetzung Festakt in Kooperation [...]
Organizer: Research Programme Intercultural Literary Studies / Programska skupina Mednarodne [...]
Tomasz Rozyckis Buch “Bestiarium” in der Übersetzung von Marlena Breuer, [...]
Wege zur Übersetzung: ein literarischer Abend mit der deutsch-slowenischen und [...]
Organizer: Research Programme Intercultural Literary Studies / Programska skupina Mednarodne [...]
Tomasz Rozyckis Buch “Bestiarium” in der Übersetzung von Marlena Breuer, [...]
Wege zur Übersetzung: ein literarischer Abend mit der deutsch-slowenischen und [...]
Das Projekt TransStar Europa, der Slowenische Lesesaal in Graz, das [...]
Star & TransStar: Ulrike Almut Sandig (Berlin) und Hryhorij Semenchuk [...]