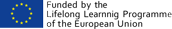Heftrich und Holan. Ein Autor, ein Übersetzer und ein lyrischer Kosmos.
 Mit Urs Heftrich, unserem Übersetzer des Monats Oktober, zu sprechen, bietet mir die Gelegenheit, einen Dichter vorzustellen, der berühmt ist, aber nicht besonders bekannt, der erwähnt wird, aber vielleicht nicht gelesen. Ich danke Herrn Heftrich für seine Bescheidenheit, daß hier nicht von einer Übersetzertätigkeit an sich (falls es so etwas gibt) die Rede ist, sondern von Vladimír Holan – von dem Jaroslav Seifert, bisher Tschechiens einziger Nobelpreisträger (um dessen Wirkkraft wir uns deshalb weniger Sorgen machen müssen), freimütig und ohne Koketterie behauptete, er sei der vielleicht beste tschechische Dichter gewesen.
Mit Urs Heftrich, unserem Übersetzer des Monats Oktober, zu sprechen, bietet mir die Gelegenheit, einen Dichter vorzustellen, der berühmt ist, aber nicht besonders bekannt, der erwähnt wird, aber vielleicht nicht gelesen. Ich danke Herrn Heftrich für seine Bescheidenheit, daß hier nicht von einer Übersetzertätigkeit an sich (falls es so etwas gibt) die Rede ist, sondern von Vladimír Holan – von dem Jaroslav Seifert, bisher Tschechiens einziger Nobelpreisträger (um dessen Wirkkraft wir uns deshalb weniger Sorgen machen müssen), freimütig und ohne Koketterie behauptete, er sei der vielleicht beste tschechische Dichter gewesen.
Der Heidelberger Slavist Heftrich ist mit Michael Špirit zusammen Herausgeber einer auf 14 Bände angelegten Gesamtausgabe, von der bereits drei Bände mit Lyrik und einer mit Holans späten Poemen erschienen sind. Alle erscheinen zweisprachig, eine große, großzügige Geste. Daß Heftrich Holans frühe Gedichte – formstreng gereimt – im Deutschen in Reimen nachbildet, ist sicherlich streitbar; da es ihm gut gelingt, wird den des Tschechischen unkundigen Lesern vielleicht ein kleines Stück Holan im Deutschen auch lautlich geschenkt. Ansonsten bietet der Dichter, wie jeder schwere Meister einer Sprache, nur die besten Gründe, das Tschechische zu erlernen.
Seiferts Aussage ist umso gewichtiger, als er und Holan Altersgenossen waren, lange Zeit Freunde und für Jahre durch die große Geschichte entzweit (obwohl beide 1949 nach kritischen Aussagen über die kommunistischen Helden gemeinsam in Ungnade fielen). So fern Holans Lyrik in weiten Teilen seines Œuvres dem tagesgeschichtlichen Treiben scheint, so sehr war sein Leben doch beeinflußt durch das 20. Jahrhundert, die deutsche Besatzung, durch den Stalinismus, der Holan isolierte: seine kurzzeitige Begeisterung für die Befreier konnte ihm nicht helfen, das Berufsverbot trieb den Kompromißlosen in Armut und Isolation.
In diesen finsteren 1950er Jahren entsteht eines seiner wichtigsten Werke: „Nacht mit Hamlet“. Dieses „Noc s Hamletem“ ist ein merkwürdiger Text, eine Schachtel voller Dialogfetzen, Zitate, aus einem reichen, biegsamen Tschechisch gebaut, angereichert mit Fremdsprachlichem, einem griechischen Motto, Zitaten in einem sehr spanischen Italienisch… Der sprachliche Eklektizismus wird auf die Figurenebene ausgeweitet. Nicht nur Hamlet erscheint, nicht nur Ophelia, sondern auch Orpheus und Eurydike als ferne mythologische Geschwister, und nicht zuletzt Julia als die andere unerreichbare Shakespeare-Geliebte. Alle haben sie ihren Auftritt in Holans unvollständigem, irreführendem Welttheater.
Ganz anders und doch verwandt die zeitgleich entstandenen Gedichte eines weiteren bereits zweisprachig erschienenen Bandes: Die Sammlungen „Víno“ („Wein“), „Strach“ („Angst“) und das umfangreiche „Bolest“ („Schmerz“) zeigen sich als Konvolute des Alltags, sie poetisieren das tägliche Leben, machen das Kleine groß, stellen das Große in Frage, mischen Sinnlichkeit und Intellekt anders, vielleicht vorsichtiger und weniger wütend. „Nacht mit Hamlet“ kann man sehen als ein Manifest ohne Nachfolge, als Aufschrei. Die kleinen Gedichte, die Holan drum herum schrieb, sind hingegen Kontemplationen: Blicke auf die Welt, gefaßt in nie ganz auflösbare Metaphern.
Ist er also so schwer? Wie liest man am besten Holan? Die Behauptung, man brauche Ruhe für Lyrik, gilt auch hier nicht; man kann ihn überall lesen, in der Bahn, im Vorübergehen, am besten aber doch in einer der Einsamkeiten, die er selbst in seinen Gedichten beschrieben hat: auf einem Stuhl in der Natur, hinter der Schranktür („moli tam hýbali šatem“, „Motten bewegten dort die Kleider“ heißt es im Gedicht „Schlaflos“), auf der Prager Kleinseite, bei Nacht. Dazu hört man die Stille, durch die Worte des Dichters noch betont. Holan, der immer Zeitlose, war auch ein Mahner der Zeit.
Seine Allianz schließt er mit dem Dunklen, er findet Tod und Einsamkeit, und klammert sich doch mit seiner Sehnsucht an das Menschliche: „Auch nicht ein einziger Schritt und Fall des Kindes in Brennesseln ist mir gleichgültig“ heißt es noch im aggressiven, fast feindlichen „Nacht mit Hamlet“. Keine Zuversicht der Religion, keine tückische Lieblichkeit, sondern die Suche nach dem Wesen des Menschen und seines Daseins. Und wie zum Trotz, am Ende, ein Vertrauen zur Erde.
Z každého stromu spadne i ten nejposlednější list,
neboť on není bez důvěry k zemi.
Von jedem Baum fällt auch das allerletzte Blatt,
denn es fehlt ihm nicht an Vertrauen zur Erde.
(„Poslední“/„Das letzte“ aus: „Strach“)
<><><>
Martin Mutschler: Wie sah Ihre erste Begegnung mit Vladimír Holan aus? Erinnern Sie sich an den ersten Eindruck, den seine Gedichte auf Sie gemacht haben?
Urs Heftrich: Allerdings, daran erinnere ich mich präzis. Es war 1987 in Prag, wo ich ein Jahr lang Material für ein Buch über Schopenhauer, Nietzsche und die tschechische Literatur sammelte. Das erstarrte Husák-Regime lag eigentlich schon auf dem Rücken wie Nosferatu im Sarg und mied das Tageslicht. Es hatte aber immer noch die Kraft, dem lebendigen Kulturaustausch das Blut auszusaugen. Offiziell war ich deshalb eingereist, um über Sozrealismus zu forschen, sonst hätte ich wohl kein Stipendium bekommen. Spaßig war es immer, wenn ich meinen offiziellen Betreuer an der Karls-Universität um seine Unterschrift bitten musste, weil ich wieder einmal ein gesperrtes Buch aus der Bibliothek brauchte, an dem die Sozrealisten so wenig Freude haben konnten wie Fledermäuse am Sonnenbaden. Bis heute rätsle ich, ob mein Betreuer dumm, gutmütig oder beides war. Interessante Bücher bekam ich auch aus den Prager Antiquariaten, zum Teil Sachen, die der Händler nicht im Regal, sondern unter der Theke hatte: katholische Dichter wie Jan Zahradníček etwa, oder den wilden, wüsten Ladislav Klíma. Einer der Titel, die ich so erstand, war beinahe nur ein Heftchen, kaum ein Buch, eine Broschüre von 53 Seiten: die Erstausgabe des „Oblouk“ („Der Bogen“) von Vladimír Holan. Darin gab es ein Gedicht mit dem Titel „Vítr“, „Wind“, und dieser Wind hat mich auf einen Schlag durchgerüttelt und völlig närrisch gemacht. Vor allem die Verse, wo der Wind „durch Myrte braust, versilbert den Delphinsopran, / hineinfaucht in den dunkel arbeitenden Feigenbaum.“ Die Gedichte des „Bogens“ waren denn auch die ersten von Holan, die ich übersetzt habe. Das Büchlein ist inzwischen irreparabel zerfleddert.
Wie würden Sie jemandem, der ihn noch nie gelesen hat, Holan beschreiben?
Den Menschen Holan hat am treffendsten Jaroslav Seifert in seinen Erinnerungen beschrieben: „Holan hatte das ein wenig dämonische, aber schöne Gesicht eines Eroberers. Es war das Gesicht eines Menschen, der niemals gern einen Kompromiss eingeht.“ Das trifft auch seine Dichtung ziemlich genau. Holan ist oft dunkel in beiderlei Wortsinn: düster und schwer zu verstehen. Und die Art, wie gerade der frühe Holan mit dem Tschechischen umging, hatte etwas von einem Konquistador. Die zivilisierte Weise, in der wir gelernt haben, unsere Muttersprache zu behandeln, interessierte ihn nur bedingt. Wenn er etwas sprachlich bezwingen wollte und ihm die Grammatik im Weg war, schrieb er sie einfach um. Aber, wie die Eroberer in früheren Zeiten, trug er bei solchen Gewaltstreichen stets eine hochgeschlossene Uniform: Sonett, Kreuzreim, Jambus. Von dieser strengen Form hat er sich erst später verabschiedet. Das ist eine besondere Herausforderung für die Übersetzung, zumal Holan diesen strengen Rahmen mit einer berauschenden Wortmusik füllt, die aber immer eine gewisse Herbheit hat, nie ins Gefällige abgleitet. Er selbst hat über 400 Seiten Rilke ins Tschechische übertragen, fand ihn aber immer eine Spur zu lieblich. Das bringt es ganz gut auf den Punkt.
Wie sind Sie die Holan-Arbeit als Übersetzer angegangen? Wie bereitet man sich auf so etwas vor?
Die Vorbereitung bestand vor allem in der Arbeit an einem anderen tschechischen Lyriker, Jan Zahradníček, aus dessen „Jeřáby“ („Vogelbeeren“) von 1933 ich eine Auswahl von dreißig Gedichten übersetzt hatte. Holans „Bogen“ entstand genau zur gleichen Zeit wie die „Vogelbeeren“, 1933-34. Die „Vogelbeeren“ sind allerdings noch formstrenger als Holans „Bogen“, da gibt es Alexandriner, raffinierte Versus rapportati und sogar ein Sonett, das die Schwerkraft des Genres außer Kraft setzt, weil die Quartette und Terzette Kopf stehen – sinnigerweise handelt es von einer Fontäne. Zum Erlernen des Handwerkszeugs war das ideal. Dieses Gesellenstück wurde von zwei freundlichen Meistern der Lyrikübertragung abgenommen, die ich bewundere. Der eine war Peter Demetz – seine Suhrkamp-Anthologie aus der „Poesie“ von František Halas von 1965 steht als Meilenstein der Vermittlung tschechischer Lyrik bis heute unverrückt da. „Magere Ähre ist dein Leib / entrollt ein Korn das keimt nicht mehr“, solche Verse vergisst man nicht. Der andere war Ralph Dutli, dessen deutscher Osip Mandelstam aus dem Ammann Verlag eine Art Leitstern für die Holan-Edition bildet. Die Kritik dieser beiden hat mich vorangebracht. Ralph Dutli hat mir beispielsweise abgewöhnt, Reime durch Inversionen zu gewinnen. Das verringert zwar den ohnehin schmalen sprachlichen Spielraum, aus dem man Reime schöpfen kann, aber ich habe diesen Verzicht nie bereut. Wenn der Holan unserer Edition, wie ich hoffe, modern klingt, und nicht nach neunzehntem Jahrhundert, so vor allem dank dieser entscheidenden Lektion. Die Lektüre von Reiner Kunzes kongenialen Jan Skácel-Übertragungen rechne ich auch zu den Vorbereitungen – als Schule gegen Geschwätzigkeit. Dort lernt man, wieviel mehr weniger ist.
Wie verändert sich die eigene Übersetzungspraxis durch eine solche langjährige Arbeit?
Die Demut wächst. Ansonsten hat sich, jedenfalls bei mir, substanziell nicht viel geändert: es ist immer wieder von neuem die gleiche Jagd nach der perfekten Lösung, die sich immer wieder entzieht, weil es sie nicht gibt, nicht geben kann. Bleibt also die Suche nach dem besten Kompromiss, und die ist dann oft erstaunlich befriedigend, jedenfalls für einen selbst. Verblüffend konstant über die Jahre bleibt beim Übersetzen gereimter Lyrik auch noch ein Weiteres: die Unberechenbarkeit bei der großen Lotterie der Sprache. Manchmal bieten sich die Reimwörter mit geradezu unanständiger Direktheit an, das Wiesel kommt ganz von selber zum Bachgeriesel. Dann wieder sucht man sich dusselig und greift in letzter Not zum Reimlexikon oder rückläufigen Wörterbuch, die einen absolut verlässlich im Stich lassen. Frau Fortuna mag es nicht, wenn man schummelt. Dafür belohnt sie einen bisweilen, wenn man es am wenigsten erwartet. Ich habe schon wiederholt nach stundenlanger Pirsch auf einen Reim die Flinte ins Korn geworfen: zwecklos, hinter diesen beiden Versen versteckt sich kein Wiesel. Drei Wochen später schaue ich die gleichen zwei Verse eine halbe Minute lang an und sehe verdutzt: ein Hermelin! So wunderbar unkalkulierbar regiert der Zufall, wenn man versucht, zwei völlig unterschiedliche Sprachen an einem ganz bestimmten Punkt zur Deckung zu bringen. Ich kenne deshalb kein besseres Rezept gegen übersetzerische Routine als die strukturadäquate Übertragung gereimter Lyrik. Eigentlich wäre ein Warnhinweis angezeigt: Lyrikübersetzen kann süchtig machen.
„Noc s Hamletem” sticht aus seinem Werk in gewisser Weise heraus. Wie beurteilen Sie dieses Werk?
Da scheiden sich die Geister, in der Tat. Der tschechische Literaturwissenschaftler Přemysl Blažíček, der einige der gescheitesten Sachen zu Holan geschrieben hat und eigentlich zu den großen Bewunderern des Dichters zählte, fand dieses Poem überschätzt. Ja, er äußerte den Verdacht, Holans nächtliches Geistergespräch mit Shakespeares berühmtester Figur sei in Wahrheit Effekthascherei auf höchstem Niveau, sein Tiefgang nur vorgetäuscht. Michael March fand, „Nacht mit Hamlet“ halte dem Vergleich mit Eliots „The Waste Land“ und Ginsbergs „Howl“ stand. Für Jiří Gruša war es eines seiner Lieblingsbücher. Ich glaube, dass sich Blažíček geirrt hat. Holan hat in Shakespeares fragwürdigem Helden seinen wohl unangenehmsten eigenen Charakterzug, nämlich seine Misogynie, gespiegelt und kritisch hinterfragt. So gesehen, ist „Nacht mit Hamlet“ vielleicht sogar einer seiner mutigsten Texte. Ich würde aber auf keinen Fall Holan als einen auctor unius libri betrachten wollen, wie es manche der Lobhymnen auf „Nacht mit Hamlet“ nahelegen. Das Außergewöhnliche an diesem Dichter ist ja, dass er sich mit einer Radikalität, die nur wenigen gegeben ist, permanent zu wandeln verstand – und dies nicht unter dem Druck irgendwelcher politischen Vorgaben oder literarischer Moden, sondern aus eigenem, inneren Antrieb. Unsere Ausgabe dieses modernen Proteus begann zwar mit „Nacht mit Hamlet“, aber sie soll zum Schluss 14 Bände umfassen. Und jeder dieser Bände ist für eine Überraschung gut.
von Martin Mutschler
Relying on the structure and methodology of classical and postclassical [...]
Organizer: Research Programme Intercultural Literary Studies / Programska skupina Mednarodne [...]
Relying on the structure and methodology of classical and postclassical [...]
Organizer: Research Programme Intercultural Literary Studies / Programska skupina Mednarodne [...]
Star & TransStar: Ulrike Almut Sandig (Berlin) und Hryhorij Semenchuk [...]
Im Rahmen des Projekts Übersetzungswürfel entstanden fünf kurze Filme mit [...]
Erschienen als Beitrag zum Projekt “Übersetzungswürfel – Sechs Seiten europäischer [...]
Star & TransStar: Ulrike Almut Sandig (Berlin) und Hryhorij Semenchuk [...]
Im Rahmen des Projekts Übersetzungswürfel entstanden fünf kurze Filme mit [...]
Erschienen als Beitrag zum Projekt “Übersetzungswürfel – Sechs Seiten europäischer [...]
Eine Reise durch die Kunst der Übersetzung Festakt in Kooperation [...]
Eine Reise durch die Kunst der Übersetzung Festakt in Kooperation [...]
Organizer: Research Programme Intercultural Literary Studies / Programska skupina Mednarodne [...]
Tomasz Rozyckis Buch “Bestiarium” in der Übersetzung von Marlena Breuer, [...]
Wege zur Übersetzung: ein literarischer Abend mit der deutsch-slowenischen und [...]
Organizer: Research Programme Intercultural Literary Studies / Programska skupina Mednarodne [...]
Tomasz Rozyckis Buch “Bestiarium” in der Übersetzung von Marlena Breuer, [...]
Wege zur Übersetzung: ein literarischer Abend mit der deutsch-slowenischen und [...]
Das Projekt TransStar Europa, der Slowenische Lesesaal in Graz, das [...]
Star & TransStar: Ulrike Almut Sandig (Berlin) und Hryhorij Semenchuk [...]