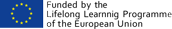Foto © Elenmari Pletikos Olof, Premantura 2014
Foto © Elenmari Pletikos Olof, Premantura 2014
Klaus Detlef Olof, geboren 1939 in Sachsen-Anhalt, ist Slawist und Übersetzer. Er studierte Slawistik in Hamburg und Sarajevo. Ab 1973 lehrte er an der Slawistik der Universität Klagenfurt, später auch an den Universitäten Graz und Wien. Heute lebt er in Zagreb. 1991 erhielt er den österreichischen Staatspreis für literarische Übersetzer. Er übersetzt aus den südslawischen Literaturen. Zu den von ihm übersetzen Autoren zählen u.a. France Prešeren, Miroslav Krleža, Miljenko Jergović, Zoran Ferić, Dževad Karahasan und Dragan Velikić. An einem der ersten Frühlingstage haben wir Herrn Olof in Graz bei einer Tasse Kaffee zu seinem Werdegang und seiner Tätigkeit als Übersetzer interviewt.
Wie sind Sie eigentlich zum Übersetzen gekommen?
Ich war seinerzeit Assistent an der sehr jungen Slawistik in Klagenfurt, wo vorwiegend Kärntner Slowenen studierten. Dort haben wir es uns Anfang der siebziger Jahre zur Aufgabe gemacht, enge Kontakte mit der Slawistik in Ljubljana herzustellen. Das Ergebnis dieser Kooperation waren wissenschaftliche Tagungen und ein gegenseitiger Austausch zu einer Zeit, als die Beziehungen zwischen Österreich und Slowenien nicht zuletzt auch aufgrund des Ortstafelsturms keine wirklich guten waren. Da haben wir ein bisschen die Tür aufgestoßen und auch ein größeres Projekt der Zusammenarbeit konzipiert, das unter anderem die Herausgabe einer zweisprachigen Anthologie slowenischer Lyrik der Nachkriegszeit vorsah. Einige der für die Anthologie vorgeschlagenen Gedichte waren noch nicht übersetzt, und so versuchte ich mich an ihnen. Matej Bors “Srečanje” war das erste Gedicht, das ich in meinem Leben übersetzt habe. Vier Wochen habe ich dafür gebraucht. Da habe ich mich richtig reingebissen und großen sportlichen Ehrgeiz entwickelt. Die meisten Gedichte hingegen waren bereits von diesem oder jenem bekannten Übersetzer übersetzt worden, und so wandten wir uns an sie und baten um die Abdruckgenehmigung. Als die Gedichte langsam eintrudelten, bestand meine Aufgabe als Redaktionsmitglied darin, Original und Übersetzung zusammenzuführen. Aber das war in vielen Fällen kaum möglich. Entweder fehlten Strophen, oder es waren welche hinzugekommen. Also bat ich die Übersetzer, vor allem unter dem Aspekt des Paralleldrucks von Original und Übersetzung, um Nachbesserung. Keiner der insgesamt vierzehn Übersetzer würdigte mich einer Antwort, also blieb die Nachbesserung an mir hängen. Zum Schluss hatte ich von den achtzig vorgesehenen Gedichten fünfzig neu übersetzt, weshalb ich mit Fug und Recht diese Anthologie als „meine“ bezeichnen kann: “Na zeleni strehi vetra/Auf dem grünen Dach des Windes“. So hat es damals angefangen. Ein zweiter Anstoß kam von einer meiner Studentinnen. In einer Schülerzeitung hatte sie sich noch über Bruno Kreisky, den damaligen Bundeskanzler Österreichs, mokiert, er habe den kärntnerslowenischen Studenten in Klagenfurt einen Professor aus Deutschland vorgesetzt, der kein Slowenisch könne. Als sie dann Redaktionsleiterin des kärntnerslowenischen Mladje wurde, machte sie mir den provozierenden Vorschlag, für ihre Zeitschrift den “Sonettenkranz” von France Prešeren zu übersetzen … Die Gute! (lacht) Sie hatte ja so recht. Ich willigte ein, und als der Zyklus dann erschienen war, schlug mich eine Professorin des slowenischen Gymnasiums für den Österreichischen Staatspreis vor.
Ihr erster Schritt war also im Bereich der Lyrik.
Genau. Aber dann standen plötzlich zwei junge Männer vor meiner Tür, die Gebrüder Wieser (Lojze und Peter, Anm.), die damals zusammen den Drava-Verlag leiteten. Lojze Wieser hatte die Idee, Literatur aus dem Südosten für den deutschsprachigen Raum modern aufzubereiten, und meinte, es sei angezeigt, sich an einen Slawisten zu wenden. So standen wir in Krumpendorf bei mir auf dem Balkon und sprachen über seine zwei Lieblingsbücher, die “Maiglöckchen” von Prežihov Voranc und den “Tantadruj” von Ciril Kosmač. Und als die dann wirklich auf Deutsch erschienen waren, schrieb Karl Markus Gauß in der ZEIT zwei Lobeshymnen über die slowenische Literatur. Diese beiden Rezensionen haben eine regelrechte Lawine losgetreten. Die Anthologie, der “Sonettenkranz” und die Gebrüder Wieser sind also die Wegmarken, die mein übersetzerisches Schicksal bestimmt haben. Als viertes Moment kam der ausbrechende Jugoslawienkonflikt hinzu, als reihenweise Autoren vor allem aus Bosnien, aber auch aus Serbien, zuerst in Zagreb Zuflucht suchten, wo sie mit Nenad Popović vom Durieux-Verlag Kontakt aufnahmen, der sie häufig an Lojze Wieser in Klagenfurt weitervermittelte. Also, nur um einmal drei Autorennamen zu nennen: Dragan Velikić, Bogdan Bogdanović und Dževad Karahasan. Sie kamen nach Klagenfurt, wohnten zum Teil im Verlag und hatten ihre Manuskripte dabei. Lojze Wieser gelang es dann über seine politischen Kanäle Mittel aufzutreiben. Tja, und als es darum ging, diese Autoren zu übersetzen, hatte ich plötzlich alle Hände voll zu tun. Das war Mitte der 90er.
Während der 90er sind gerade auch viele Schriftsteller nationalistischen Positionen verfallen. Haben Sie sich einmal, um es so zu sagen, aus ideologischen Gründen geweigert, einen Autor ins Deutsche zu übersetzen?
Ja, einmal. Das war ein serbischer Autor, von dem ich geraume Zeit vorher schon etwas übersetzt hatte und von dem jetzt ein größerer Essayband anstand. Aber seine aktuellen nationalistischen Äußerungen haben mir einfach die Lust genommen und mich zugegebenermaßen nicht sehr professionell reagieren lassen. Ich habe die ganze Sache so sehr verschleppt, bis es auch dem namhaften Grazer Verlag zu viel wurde und er das Projekt sterben ließ. Das war aber das einzige Mal. Ansonsten waren die Autoren durch die Bank Jugoslawen im geistigen Sinne, keine Nationalisten. Wissentlich habe ich damals jedenfalls keinen Nationalisten übersetzt. Schließlich habe ich Anfang der 60er Jahre in Sarajevo studiert und bin unter diesem geistigen Vorzeichen somit auch selbst „Jugoslawe“. Auch der nationalistische Sprachenstreit ist mir fremd, für mich haben ein Montenegriner, ein Bosnier, ein Serbe, ein Kroate immer die gleiche Sprache gesprochen und geschrieben, wenngleich sie sich, wie es in jeder größeren Sprache der Fall ist, im kulturellen Überbau unterscheiden.
Für wie wichtig halten Sie es als Übersetzer, den Schriftsteller persönlich zu kennen?
Persönliche Kontakte sind nicht unbedingt notwendig, um einen Text richtig interpretieren und gut übersetzen zu können. Aber sie sind eine Bereicherung. Wenn Dževad Karahasan nach Graz kommt, setzen wir uns mitunter zusammen. Da gibt es ein bestimmtes Lokal, wo man gemeinsam etwas zu sich nimmt und über dieses und jenes redet. Nicht über Literatur! Man schwimmt da eine gewisse Zeit auf den Gedankengängen und im Sprechrhythmus dieses Menschen mit und versucht das in die eigene Sprache mit hinüberzunehmen. Natürlich kann es hilfreich sein, Hintergründe, Stimmungen, eine Aura oder Ähnliches zu erfahren. Aber letztlich gibt es unzählige Autoren, die ich übersetzt habe, ohne sie jemals persönlich kennen gelernt zu haben. Prešeren, zum Beispiel (lacht).
Sie haben ja auch von Miroslav Krleža “Die Rückkehr des Filip Latinović” neu übersetzt…
Ja… (senkt den Blick)
Sind Sie zufrieden mit der Übersetzung?
Nein. (lächelt)
Warum nicht?
Es war ein erzwungener Schnellschuss. Es gibt ältere Übersetzungen, die ich zurate gezogen habe bzw. aus denen ich hier und da wohl auch etwas übernommen habe, ohne die Übernahme besonders kenntlich zu machen. Über die Arbeit an diesem Buch bin ich wirklich nicht glücklich. Ich arbeite jetzt an Krležas Reisebericht “Izlet u Rusiju” (1925). Eine Europareise, die ihn über Wien, Berlin und die baltischen Staaten ins gelobte Land des Kommunismus geführt hat, in den Kreml und an Lenins Grabstätte. Irgendwo versuche ich wohl, meine Schuld an Krleža abzuarbeiten.
War es dann grundsätzlich hilfreich, diese älteren Übersetzungen zurate zu ziehen oder eher eine Vorformung, aus der man dann schwer wieder herausfindet?
Letzteres ist richtig. Es ist im Grunde etwas, das verboten gehört, so darf man nicht arbeiten. Wenn jetzt jemand hinginge und eine Diplomarbeit darüber schriebe und die Übersetzung zerpflückte, hätte ich vollstes Verständnis dafür!
Um auf die Sprachenfrage zurück zu kommen. Sie haben gesagt, Sie sehen Bosnisch, Kroatisch, Serbisch, Montenegrinisch als eine Sprache mit verschiedenen kulturellen Überbauten. Macht es für Sie einen Unterschied, ob Sie zum Beispiel aus dem Serbischen oder aus dem Kroatischen übersetzen?
In der Zwischenzeit, immerhin sind seit dem Zerfall Jugoslawiens bereits 20 Jahre vergangen, macht es einen Unterschied. Wörter und Ausdrücke sind in dieser Zeit eingeflossen, die ihre regionale Verankerung haben und die nur dort gekannt werden, also nicht mehr serbokroatische Koinē sind. Das war früher anders, als es diesen zweifachen Standard gab und man zwischen den beiden Standards, dem Serbisch-Kroatischen und dem Kroatisch-Serbischen, wählen konnte. Bosnisch hat es damals ja überhaupt noch nicht gegeben. Heute haben die nationalen Sprachpfleger natürlich sehr viel hineingepusht. Da wurde alles Mögliche aufgenommen, was mir so ad hoc nicht zugänglich ist und was recherchiert gehört. Andererseits, und das ist tröstlich, ist der Anteil nationalistischer Schriftsteller in allen vier Entitäten verschwindend gering. Wer über seinen Tellerrand hinaussieht, der möchte auch über die Grenzen seines Nationalstaates hinaus verstanden werden. Und den Verlagen liegt ebenfalls daran, dass sich ihre Bücher auch in den „Bruderstaaten“ verkaufen lassen. Viel versprechend scheint mir zu sein, zu einem Anfang Juni in Zagreb stattfindenden Wettbewerb Autoren einzuladen, „die in Sprachen schreiben, für die es keiner Übersetzung bedarf“. Für andere ex-jugoslawische Sprachen wie zum Beispiel für das Slowenische bedeutet es ja geradezu eine Öffnung, einen Schritt hin zu einer Art “Weltsprache”, wenn sprachliche Varietäten in die Literatur hineinkommen. Ich denke da an die Vorstadtsprachen, die Soziolekte, die Sprachen der Neubürger. Fužine etwa ist ein Stadtteil von Ljubljana, der zu einem hohen Prozentsatz von Zuwanderern aus den ehemaligen Teilrepubliken Jugoslawiens bevölkert wird. Dort hat sich im Verlauf von zwei, drei Generationen eine eigene Sprachqualität herausgebildet, dort ist das Jugoslawische oder Serbokroatische ins Slowenische eingeflossen. Die Kosovaren, Bosnier, Serben, die dort leben, sprechen ein Slowenisch mit allerlei Einsprengseln, quasi ein Fužine-Deutsch (lacht). Ich sitze jetzt vor einem Roman, der in diesem Milieu spielt, und tu mir wahnsinnig schwer mit der Frage, wo ich die Sprache des Romans im Deutschen ansiedeln soll, in Köln, München, Hamburg, Berlin? Oder soll ich einen künstlichen Soziolekt verwenden?
Sie haben also noch keine Lösung?
Nein, ich mache jetzt eine Rohübersetzung, um überhaupt erst einmal das Material zu sichten. Aber den sprachlichen Aufputz, also die ganze Emotion, die Wärme, menschliche Nähe und Ferne, die müssen noch warten. Ich werde mich mit Leuten beraten müssen, die so etwas schon einmal gemacht haben. Vielleicht gibt es Lösungen in Übersetzungen aus dem Italienischen, wo Sizilianer oder Kalabreser nach Mailand kommen …
Ein ähnliches Problem ist es zum Beispiel auch, wenn serbische Elemente in einem kroatischen Roman vorkommen. Welche Lösungen haben Sie für solche Fälle?
Ein Generalrezept gibt es da nicht. In der Zeit des gemeinsamen Militärs war die Befehlssprache Serbisch, das wäre in einem kroatischen Text markiert, überwiegend negativ … Technisch geht es wohl nur so: Zuerst muss der ganze Text übersetzt werden, damit man sieht, welchen Stellenwert die einzelne Anspielung hat. Wie stark muss sie tatsächlich hervorgehoben werden? Lässt sie sich durch andere Mittel aufheben? Die Intention des Autors insgesamt (Ironie, Sarkasmus etc.) muss natürlich erhalten bleiben … Mit Sprachmischung ist das so eine eigene Sache. Ich habe von Lojze Kovačič die dreiteilige Autobiographie („Die Zugereisten“, Anm.) übersetzt, wo er mit seinem Schweizerdeutsch aus Basel ausgesiedelt wird und als Zwölfjähriger nach Ljubljana kommt. Der Roman handelt zu einem großen Teil von seiner Sprachfindung, von seinem Heimischwerden im Slowenischen. Zu Anfang spricht er grammatikalisch völlig verdreht und verquer, mit falscher Aussprache. Das sollte die Übersetzung in erkennbarer Weise wiedergeben und rüberbringen. In diesem Fall habe ich mir mit Fußnoten geholfen, sogar mit doppelten. So steht etwa im deutschen Text der verballhornte slowenische Satz, in der Fußnote steht die slowenische Hochübersetzung, gefolgt von der deutschen Übersetzung, damit das Kauderwelsch erkennbar wird, das der Junge am Anfang spricht und aus dem er sich erst im Lauf der Zeit herauswurstelt. Diese Entwicklung musste also in der Übersetzung dokumentiert werden, denn sie ist das konstitutive Element dieses Lebensromans.
Wie sieht Ihr praktischer Zugang zu einer Übersetzung aus? Es geht das Gerücht um, dass Sie ein Buch erst beim Erstellen der Rohübersetzung lesen.
Ein Gerücht geht um?! (lacht) Nun ja, man kann es so sagen. Ich habe nicht viel Zeit zum Lesen, schlafe zumeist auch dabei ein. Vielleicht möchte ich aber auch mal etwas Anspruchsloses lesen. Also, ich benutze da so ein Programm, das den Text in einzelne Sätze zerlegt, unter die ich meine Erstübersetzung schreibe, Satz für Satz. Das geht oft ein wenig mechanisch vonstatten, und ich arbeite mit vielen Sternchen für sachlich Unklares und Schrägstrichen für Bedeutungsnuancen. Bei dieser Arbeitsweise erschließt sich mir der zusammenhängende Text erst nach dem ersten Durchgang. Der Vorteil, so versuche ich mir einzureden, ist der, dass ich so lange wie möglich ein unvoreingenommener Erstleser bleibe und mir nicht den Blick verstelle.
Hat dieser Zugang noch andere Vorteile für Sie persönlich?
Wenn ich einen Text in die Hand nehme, der übersetzt werden will, darf ich mich nicht verzetteln, indem ich ihn genieße. Der Genuss kommt später, ganz zum Schluss, z. B. bei einer Lesung der lektorierten und gedruckten Übersetzung, wenn man merkt, dass man das Publikum packt. Das heißt, es ist ein langsames Vortasten. Ich bin jetzt bei Krležas Russlandreise in Berlin, wo er die die Große Berliner Kunstausstellung von 1925 besucht, ein Kapitel, in dem er über Kokoschka, Klee, Kandinsky, Picasso usw. schreibt, deren Bilder er dort gesehen hat. Er schreibt aber auch über die weiter zurückliegende Auseinandersetzung der Leute um Herwarth Walden und die Zeitschrift „Der Sturm“ mit den Alt-Berlinern wie Liebermann, Slevogt, Corinth usw., über Naturalisten und Impressionisten. Es ist ein ziemliches Durcheinander, weil er offenbar auch andere Ausstellungen besucht hat. Er verfolgt da keine klare Linie, sondern thematisiert die „Krise in der Malerei“ anhand von Berliner und Münchner Malerschulen und ihrem Einfluss auf kroatische Epigonen. Die Rohübersetzung ist gemacht, die Fakten und Namen sind gesammelt, und doch ist kein Licht am Ende des Tunnels. Jetzt heißt es Nachgraben und Nachjustieren, ich muss mich in die Zeit versetzen, in der Krleža sich zum maßgeblichen kroatischen Kunstkritiker entwickelt hat, der selbst auf Tito dahingehend einwirken konnte, dass dieser den Künstlern die notwendigen Freiheiten gewährte. Wenn ich den Text vorher genießerisch zu lesen versucht hätte, hätte ich mich sicherlich nicht an seine Übersetzung gemacht. So sieht es aus. Hoffentlich habe ich Sie nicht enttäuscht. (lächelt)
Nein, nein, ganz im Gegenteil. Es ist wahnsinnig interessant, diese Geschichten aus der Praxis zu hören, gerade auch, weil man während des Studiums ohnehin mit sehr viel Theorie konfrontiert wird.
Das finde ich auch ganz richtig so, denn Sie sollen ja fundiert und allseitig ausgebildet werden. Eine derartige fachliche Ausbildung auf diesem Gebiet habe ich nicht. Dies und das an Theorie habe ich mir angelesen, weil ich auch meine Lehrveranstaltungen untermauern musste. Am liebsten habe ich mich aber doch auf die praktischen Aspekte konzentriert. Mir persönlich hat das Buch von Jiří Levý „Die Kunst des Übersetzens“ viel gegeben, es enthält ein Menge praktischer Hinweise gerade aus den slawischen Sprachen. Bei Umberto Eco habe ich viele Anregungen gefunden. Aber meine Theorie des literarischen Übersetzens ist rudimentär und besteht doch eher in einer nachträglichen Deutung des eigenen Vorgehens. Wenn ich Lyrik übersetze, brauche ich nicht viel Abstraktes, da geht es um Form, Rhythmus und Klang, um das Suchen von Äquivalenten und nicht zuletzt um die Selbstbescheidung im künstlerischen Überschwang. Das Wichtigste für einen literarischen Übersetzer bleibt das Lesen guter Literatur in der eigenen Sprache. Um sich beizeiten einen Fundus anzulegen, aus dem man bei Bedarf schöpfen kann. Allerdings scheint mir im Nachhinein das Lesen ein Privileg der Jugend zu sein, nicht des rastlosen Alters.
Ihrer Meinung nach ist also das Beherrschen der deutschen Sprache wichtiger für eine gute literarische Übersetzung als das Beherrschen der Ausgangssprache?
Naja, in der Ausgangssprache sollte man wenigstens ein Gespür dafür entwickeln, wo die schwarzen Löcher sind, um gegebenenfalls hinterfragen zu können, damit man sich nicht selber über möglicherweise entscheidende Schichten, Bedeutungen, Konnotationen hinwegtäuscht. Beim Umbilden in die Zielsprache ist dann sprachliche Kreativität gefordert, die aber mit Selbstdisziplin und Zurückhaltung einhergehen muss, damit man nicht übers Ziel hinausschießt und etwas hineininterpretiert, was nicht hinein gehört. Das ist auch eine ethische Frage, eine moralische Verpflichtung gegenüber dem Autor. Wie es auch die Pflicht des Übersetzers ist, im Text nach dem Rechten zu sehen, also offensichtliche Versehen des Autors zu korrigieren. In solchem Fall ist der Übersetzer das alter ego des Autors. Er muss sorgfältig lesen, und wenn er bemerkt, dass etwas nicht Hand und Fuß hat, sollte er mit dem Autor Zwiesprache halten. Zumindest im Geiste.
Als letzte Frage: Was macht für Sie bis heute die Faszination am Übersetzen aus?
Es sind mehrere Motive, die mich bewegen. Am Anfang habe ich mich vielleicht ein wenig geschmeichelt gefühlt, wenn man an mich herangetreten ist, dies und das zu machen, und ich damit Erfolg hatte. Eine Zeit lang war es auch so, dass ich eine Schuld abgelöst habe. Ich habe ja ein ganzes Studienjahr in Sarajevo verbracht, wenngleich sich mein Hörsaal zumeist in den Kaffeehäusern befunden hat, wo ich das legere bosnische Leben studieren konnte. Allerdings habe ich in Sarajevo nicht nur Würfeln und Kartenspielen, sondern auch ein tolerantes Miteinander schätzen gelernt. So manches aus der Zeit ist an mir hängen geblieben. (lacht) Als dann der Krieg ausbrach, stürzte auch für mich eine Welt ein. Ich war mitbetroffen, aber ich konnte helfen. Deshalb auch die vielen Autoren in meiner Bibliografie, die die Linie der Toleranz und des Miteinanders vertreten und sich dem grassierenden Nationalismus verweigert haben. Aus Sarajevo zum Beispiel der unbestechliche Kritiker Ivan Lovrenović und der ironisch-nostalgische Chronist Mile Stojić. Das waren meine Autoren, über die ich etwas von dem zurückgeben wollte, was ich in meiner Zeit in Bosnien erfahren habe. Aber es gab natürlich auch eine Zeit des Ehrgeizes und des Kampfes. Prešeren, mein Lieblingsdichter, reizt mich noch immer zum sportlichen Zweikampf. Oder jetzt Krleža. Dann wieder gehe ich es ruhiger an und mache etwas mit Freunden. Die neue Ausgabe der Lichtungen zum Beispiel, die im Gedenkjahr 2014 einen Bosnien-Herzegowina-Schwerpunkt hat, an dem ich mit viel Freude mitgearbeitet habe, weil ich die Autoren fast alle kenne. In den letzten Jahren habe ich auch immer wieder aktuelle Theaterstücke übersetzt und sie bei der Biennale „Neue Stücke aus Europa“ in Wiesbaden den Zuschauern simultan in die Kopfhörer gesprochen. Das macht noch immer Spaß. Im Juni ist ein Stück des kroatischen Regisseurs Oliver Frljić über Zoran Đinđić in einer Belgrader Inszenierung an der Reihe. Und wer weiß, vielleicht kommt dann etwas ganz Neues, was ich noch gar nicht gemacht habe. Neugierig bin ich noch immer.
Herr Olof, vielen Dank für das Gespräch!
Das Gespräch führten Evelyn Sturl und Paul Gruber.
Relying on the structure and methodology of classical and postclassical [...]
Organizer: Research Programme Intercultural Literary Studies / Programska skupina Mednarodne [...]
Relying on the structure and methodology of classical and postclassical [...]
Organizer: Research Programme Intercultural Literary Studies / Programska skupina Mednarodne [...]
Star & TransStar: Ulrike Almut Sandig (Berlin) und Hryhorij Semenchuk [...]
Im Rahmen des Projekts Übersetzungswürfel entstanden fünf kurze Filme mit [...]
Erschienen als Beitrag zum Projekt “Übersetzungswürfel – Sechs Seiten europäischer [...]
Star & TransStar: Ulrike Almut Sandig (Berlin) und Hryhorij Semenchuk [...]
Im Rahmen des Projekts Übersetzungswürfel entstanden fünf kurze Filme mit [...]
Erschienen als Beitrag zum Projekt “Übersetzungswürfel – Sechs Seiten europäischer [...]
Eine Reise durch die Kunst der Übersetzung Festakt in Kooperation [...]
Eine Reise durch die Kunst der Übersetzung Festakt in Kooperation [...]
Organizer: Research Programme Intercultural Literary Studies / Programska skupina Mednarodne [...]
Tomasz Rozyckis Buch “Bestiarium” in der Übersetzung von Marlena Breuer, [...]
Wege zur Übersetzung: ein literarischer Abend mit der deutsch-slowenischen und [...]
Organizer: Research Programme Intercultural Literary Studies / Programska skupina Mednarodne [...]
Tomasz Rozyckis Buch “Bestiarium” in der Übersetzung von Marlena Breuer, [...]
Wege zur Übersetzung: ein literarischer Abend mit der deutsch-slowenischen und [...]
Das Projekt TransStar Europa, der Slowenische Lesesaal in Graz, das [...]
Star & TransStar: Ulrike Almut Sandig (Berlin) und Hryhorij Semenchuk [...]