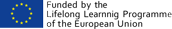Ob sie vom Übersetzen leben könne, wurde Esther Kinsky in einem Interview einmal gefragt. Die Antwort fiel knapp aus: Ohne die Übersetzerförderung privater und staatlicher Stellen sei daran nicht zu denken.
Dass der Beruf des literarischen Übersetzers wenig einträglich ist, weiß inzwischen jeder. Doch dafür sind Übersetzer Kulturvermittler, sie bringen Völker zusammen, machen fremde Literaturen denjenigen zugänglich, die keine Zeit oder Möglichkeit haben, Sprachen zu lernen. Und genau aus diesem Antrieb macht man die Sache ja auch, oder etwa nicht? Für Esther Kinsky ist gerade dieser Aspekt des Übersetzens nicht entscheidend. Einblicke in andere Kulturen und Gepflogenheiten sind für sie, so heißt es in der Einleitung zu ihrem 2013 erschienenen Essay „Fremdsprechen“, ein Nebenprodukt des Übersetzens, aber nicht sein Sinn und Zweck.
Wesentlich ist für sie etwas anderes: die Auseinandersetzung mit der eigenen Sprache und ihre Formbarkeit. Weil der Übersetzer bei seiner Arbeit permanent mit Ausdrucksmitteln konfrontiert wird, die der Muttersprache fremd sind, gilt es, so Kinsky im oben genannten Essay, sich diese Muttersprache in all ihrem Potential zu Bewusstsein zu bringen und ihre Mittel und Möglichkeiten auszuloten, um für das Wort in der einen Sprache, mit all seinen Bezügen und Konnotationen, eine wenigstens annähernde Entsprechung in der anderen zu finden.
Ein Beispiel aus der Werkstatt des Autors dieses Beitrags: Die handelnden Personen sind zwei Jungen und ein Mädchen: „Całowaliśmy się z Sarą”. Was auf Polnisch – und ähnliche Konstruktionen gibt es wahrscheinlich in den meisten anderen slavischen Sprachen – einen gewissermaßen egalitären Charakter hat, ist im Deutschen nicht ohne Weiteres wiederzugeben. „Wir küssten Sara“, „Sara küsste uns“ (wo sagt das Original, von wem das Küssen ausgeht?), „Wir knutschten miteinander“ (knutscht wirklich auch ein Junge mit dem anderen?)? Varianten, manche davon genauso unbefriedigend, wie diese hier, manche sicherlich auch gelungener, gäbe es noch mehr und ich verzichte an dieser Stelle darauf, weitere zu nennen. Was bleibt, ist die Erkenntnis, dass auch die scheinbar banalsten Sätze dazu zwingen, tief im Speicher der eigenen Sprache zu graben, um eine passende Übersetzung zu finden.
Übersetzen ist für Esther Kinsky in erster Linie Arbeit an der eigenen Sprache, Hinterfragen von Konventionen, der Versuch, im Umgang mit dem Anderen dem Eigenen neue Ausdrucksmittel abzuringen. Ein „Prozess der Verwandlung“, wie sie es nennt, an dem die eigene Sprache wächst und an dessen Ende zumindest eine gewisse Harmonie zwischen den Texturen von Original und Übersetzung stehen soll.
Eine Harmonie jedoch, so betont Esther Kinsky in ihrem Essay, die immer dem subjektiven Empfinden des Übersetzers entspringt, seiner persönlichen Auseinandersetzung mit einem Ausgangstext. Das Ergebnis dieser Auseinandersetzung stellt keine Konkurrenz für das Original dar, es ist auch keine Imitation, sondern ein Dialog mit der Fremde, „aus dem eine eigene Struktur erwächst, durch die sich der Übersetzungstext auch für den ganz außenstehenden Leser als Ahnung des Anderen vermittelt, ein Anderes, das im Gewebe des Eigenen bewahrt bleibt.“
von Jakob Walosczyk
Relying on the structure and methodology of classical and postclassical [...]
Organizer: Research Programme Intercultural Literary Studies / Programska skupina Mednarodne [...]
Relying on the structure and methodology of classical and postclassical [...]
Organizer: Research Programme Intercultural Literary Studies / Programska skupina Mednarodne [...]
Star & TransStar: Ulrike Almut Sandig (Berlin) und Hryhorij Semenchuk [...]
Im Rahmen des Projekts Übersetzungswürfel entstanden fünf kurze Filme mit [...]
Erschienen als Beitrag zum Projekt “Übersetzungswürfel – Sechs Seiten europäischer [...]
Star & TransStar: Ulrike Almut Sandig (Berlin) und Hryhorij Semenchuk [...]
Im Rahmen des Projekts Übersetzungswürfel entstanden fünf kurze Filme mit [...]
Erschienen als Beitrag zum Projekt “Übersetzungswürfel – Sechs Seiten europäischer [...]
Eine Reise durch die Kunst der Übersetzung Festakt in Kooperation [...]
Eine Reise durch die Kunst der Übersetzung Festakt in Kooperation [...]
Organizer: Research Programme Intercultural Literary Studies / Programska skupina Mednarodne [...]
Tomasz Rozyckis Buch “Bestiarium” in der Übersetzung von Marlena Breuer, [...]
Wege zur Übersetzung: ein literarischer Abend mit der deutsch-slowenischen und [...]
Organizer: Research Programme Intercultural Literary Studies / Programska skupina Mednarodne [...]
Tomasz Rozyckis Buch “Bestiarium” in der Übersetzung von Marlena Breuer, [...]
Wege zur Übersetzung: ein literarischer Abend mit der deutsch-slowenischen und [...]
Das Projekt TransStar Europa, der Slowenische Lesesaal in Graz, das [...]
Star & TransStar: Ulrike Almut Sandig (Berlin) und Hryhorij Semenchuk [...]