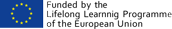Der vorliegende Text von Damir Karakaš ist aus dem 2012 erschienenen Erzählband Pukovnik Beethoven. Es handelt sich um den zweiten Teil der ersten Erzählung Das Haus, die eine unerwartete Wendung in Form von phantastischen Elementen nimmt und somit aus der üblichen Kriegsliteratur, auf die sich Karakaš keineswegs beschränkt, heraussticht. Karakaš gelingt es, mit seinem lockeren und doch tiefsinnigen Schreibstil, die Absurdität nicht nur des Krieges, sondern des Lebens überhaupt darzustellen.
Sie laufen weiter; nach einiger Zeit sehen sie ein Dorf.
Von weitem scheint es so verlassen wie diese Stadt, und Marijan wünscht sich, dass wenigstens irgendwo ein Hund bellt.
Er schob seinen Helm mit dem Daumen ein Stück nach oben und schaute angestrengt Richtung Dorf: sein Blick ging von Haus zu Haus. Das Dorf war ein Puzzle aus alten, Holz- und neuen, hauptsächlich unfertigen Häusern: die neuen hatten Wände aus rotem Backstein.
Oberst Beethoven sagte, sie sollten sich ein bis zwei Stunden ausruhen, dann sollten sie wieder aufbrechen.
Joe und Marijan stiegen die knarzende Treppe hinauf in das Innere eines der Holzhäuser. Als sie mit gezogenen Waffen säuberlich alle Zimmer durchgesehen hatten, gingen sie zurück in die Küche und setzten sich müde auf die durchgesessene Couch.
Der Wind blättert die Zeitung auf; er ist durch das Loch im Fenster gekommen und raschelte mit den Seiten. Marijan steht auf, nimmt die uralte Zeitung unter dem Tisch hervor, sein Blick bleibt beim Sportteil hängen, in dem mit fetten Buchstaben steht, dass ein Fußballer von einem kleineren zu einem größeren Verein gewechselt hat. Die Artikelüberschrift: Mein Trumpf ist der Kopf. Marijan lacht auf, er will es Joe zeigen: im letzten Moment lässt er es. Er blättert weiter in der Zeitung, bis er zu dem Teil mit den Kinos kommt.
Joe stand in der Zeit mit nacktem Oberkörper hinter dem wackeligen Tischchen, in das ein blechernes Becken eingelassen war: er wusch sich das Gesicht mit kaltem Wasser, zog sich an, fläzte sich auf die Couch und zog die Stiefel aus. Marijan schlief schon halb, hatte die Füße auf einen Stuhl abgelegt.
Joe steht schwungvoll von der Couch auf, öffnet den Kühlschrank: er ist leer – bis auf ein paar vertrocknete Früchte, zwei leere, trübe Flaschen und ein nicht ausgepacktes Päckchen Butter.
Joe nimmt die Butter, betrachtet sie von allen Seiten: das Haltbarkeitsdatum ist noch nicht überschritten.
Er schließt den Kühlschrank, holt einen Zwieback aus dem Rucksack und schmiert sich mit dem Bajonett eine Schicht Butter darauf.
Während Joe mit dem scharfen Messer in die immer weicher werdende Butter eindrang, erinnerte sich Marijan, der ihn mit hochgezogener Augenbraue anschaute, an diesen ersten Tag, als er sich bei den Freiwilligen meldete. Er erinnerte sich an das Ausbildungslager und Oberst Beethoven, der sie damals, so könnte man sagen, in einem Schnellkurs in den Kriegsfertigkeiten schulte: er lehrte sie töten.
Mit Messer, Draht, Fingern…
Er sieht erneut die Butter an, dann Joe, seine kräftige Hand die den Griff des glänzenden Bajonetts hält.
Oberst Beethoven fragte sie damals: „Wie ist es möglich, einen Menschen umzubringen, der gerade Wache hält, in der Nacht, wenn die Stille vollkommen ist, und zwar ohne das geringste Geräusch zu machen?“; ein paar übermotivierte Burschen traten hervor, erklärten: man muss dies, man muss das; der Oberst hörte ihnen ruhig und aufmerksam zu.
Als sie fertig waren, stieß er hervor: Gkkkrrr.
„Was sollen wir mit diesem Röcheln?“, fragte er.
Er wartete noch einige Zeit, ob sie antworteten.
Dann zog er aus der ledernen Hülle, die um die Hüfte geschnallt an der linken Seite hing, ein Bajonett, rief einen der Burschen; die Bewegungen des Oberst waren elastisch, bewusst eingesetzt: mit der Handfläche hielt er dem Burschen Mund und Nase zu; mit der anderen Hand näherte er die glänzende Spitze dem Hals; sein Daumen war die ganze Zeit entspannt hinter dem Griff des senkrechten Bajonetts.
„Nur leicht drückt ihr mit dem Daumen zu, das Messer wird wie durch Butter schneiden und man wird kein Geräusch hören“, sagte er.
Dann hört man einen Schrei.
Marijan dachte im ersten Moment, er träume, und Joe sagte:
„What the fuck?“
Dann hört man wieder einen längeren Schrei.
Beide gingen wortlos zum Fenster, blieben mit den Nasen in Spinnweben hängen.
Sie öffneten das Fenster und schauten gleichzeitig hinaus.
Oberst Beethoven zeigte schon mit dem Finger in Richtung des kleineren Holzhauses auf dem nächsten Hügel. Dann befahl er mit ruhiger Stimme zwei Burschen, zum Haus hoch zu gehen. Die Burschen gingen mit den Waffen in der Hand los. Als sie leichten Schrittes, als würden sie die ganze Zeit schweben, am Haus ankamen, öffneten sie die quietschende Tür und gingen hinein – ein paar Minuten vergingen – sie kamen nicht heraus. Danach hörte man wieder einen Schrei aus dem Haus: dann mehrere Schreie. Es wirkte so, als kämen die Schreie aus weiter Ferne, viel weiter entfernt als dieses Haus. Marijan spitzte die Ohren, sich bemühend, dass ihm auch kein Geräusch entging; er fokussierte seinen Blick auf das Haus. Auch Joe fixierte das Haus. Dann wieder ein Schrei. Schreie. Sie vermehrzen sich, verstärkten die Stille bis zu dem Punkt, wo die Stille in Lautstärke umschlug, von der es Marijan immer schummeriger wurde. Joe nahm die Kalaschnikow, ging zum Fenster zurück: mal schaute er auf das Haus, mal auf die Waffe, als erwarte er eine Antwort von der Waffe. Marijan hatte in der Zeit erneut einen Blick auf das Haus gehabt. Jede neue Sekunde des Starrens und des steifen Blickes auf das Haus bestätigt ihm etwas, wovon ihm langsam die Knie zitterten.
„Als wir kamen…“ bringt er gerade so hervor. „Ich glaube, dass dieses Haus gar nicht da war…“
„Wie bitte?“, runzelt Joe die Augenbrauen.
„Dieses Haus war vorhin nicht da“, sagte er.
Joe sagte: „Du erzählst Schwachsinn.“
„Dieses Haus war vorhin nicht da“, wiederholt Marijan noch leiser und schluckt seine zähe Spucke.
Oberst Beethoven geht langsam von unten auf das Haus auf dem Hügel zu, wie ein einziger Körper folgen ihm alle.
Als sie sich dem Haus genügend genähert haben, schaut der Oberst über die Schulter, sein Blick schweift kurz über die Soldaten, er mustert Joe und noch drei andere: gibt ihnen ein Zeichen mit den Augen, sein Blick bleibt beim Haus stehen.
Marijan packt Joe am Arm, er will ihm etwas sagen, weiß aber nicht, was, dann lässt er ihn langsam los. Joe packt die Kalaschnikow fester, lächelt und sagt: „Ja, ich lebe für solche Momente.“ Dann verdunkelt sich sein Gesicht schlagartig, er geht mit den anderen dreien entschlossen los Richtung Haus:
Schnell erklommen sie den Hügel, rannten im Zickzack die letzten paar Schritte, richteten die Waffen auf die Tür, fielen abrupt ein.
Oberst Beethoven rief sie nach einiger Zeit: man hörte nichts.
Wieder rief er. Nichts.
Marijan wischte die schwitzigen Hände an der Hose ab; er war sich sicher, dass dieses Haus vorher nicht da war: er zitterte am ganzen Körper.
Nach ein paar Minuten angespannter Stille, wieder Schreie: Als kämen sie nicht von dieser Welt.
Oberst Beethoven rief einige Soldaten mit Panzerfäusten; als sie sich hinknieten, zielten, die Körper anspannten, hob der Oberst langsam die Hand: aber er ließ sie nicht wieder herunter.
Marijan wartete darauf, dass das Haus verschwand; es interessierte ihn überhaupt nicht, was in dem Haus war; er wartete nur darauf, dass das Haus verschwand, auf welche Weise auch immer: dass das Haus verschwand, dass das endlich passierte.
Er kehrte den Blick vom Haus ab und schaute einige Momente auf Oberst Beethoven; er stand auch weiterhin reglos da, mit dieser erhobenen Hand, als habe man ihn in dieser Bewegung angehalten.
Als Marijan seinen Blick wieder vom Haus abwendet, sieht er, wie dem Oberst auf der Stirn Schweißperlen glänzen, sie gleiten das Gesicht hinunter und fließen langsam in dieses Grübchen am Hals; Marijan kommt es da so vor – und er hat auch schon die Augen geschlossen – dass er die Welt um sich herum zum letzten Mal sieht.
Übersetzung aus dem Kroatischen: Maja KONSTANTINOVIĆ, Tübingen